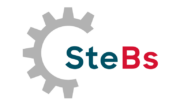Modul 7 |
Antimuslimischer Rassismus
Antimuslimischer Rassismus
#mehr als nur ein Vorurteil #Macht und Herrschaft #Institutionen und Strukturen #was tun! – Handlungsmöglichkeiten
In der folgenden Lerneinheit wird anhand von Studien und Beispielen aus dem Schulalltag muslimischer Schüler*innen in das Thema antimuslimischer Rassismus eingeführt. Es folgt eine Vorstellung des antimuslimischen Rassismus. Hierbei wird für ein Verständnis plädiert, welches weniger auf einer individuellen Ebene der Vorurteile und Einstellungen ansetzt, sondern sich dafür stark macht, antimuslimischen Rassismus komplexer zu fassen. Dieser wird dafür als eine Ideologie der Ungleichwertigkeit herausgearbeitet und in Macht- und Herrschaftszusammenhänge gestellt. Daran anschließend wird kritisch in die Begriffe Islamophobie und Islamfeindlichkeit eingeführt. Die Lerneinheit endet mit einem Nachdenken über Handlungsmöglichkeiten in der Berufsschule und eine daran angelehnte Aufgabe für die vertiefte Reflexion und Weiterarbeit mit der Thematik.
- Einstieg
- Theorie
- Aufgabe & Reflexion
- Literatur
- Weiterführende Literatur
Einblicke in Studien und Erfahrungsberichte aus dem Schulalltag muslimischer Schüler*innen
Im Jahr 2020 hat das Bundesinnenministerium (BMI) mindestens 901 Übergriffe auf Muslim*innen und islamische Einrichtungen in ganz Deutschland erfasst. Dies bedeutet, dass rechnerisch mehr als zwei Angriffe pro Tag stattgefunden haben (vgl. Mediendienst Integration, 2021). Besonders im Raum Schule, welche sich durch eine hohe Diversität auszeichnet, sehen sich muslimische und als muslimisch markierte Personen mit antimuslimischen Anfeindungen konfrontiert. In der Studie „Religion und Glauben an der Schule. Diskriminierungserfahrungen muslimischer Jugendlicher in Berliner Schulen“ (Yegane et al. 2021) geben etwa 78,3 Prozent der befragten Schüler*innen an, das Gefühl zu haben, aufgrund ihrer Herkunft in der Schule härter arbeiten zu müssen als ihre Mitschüler*innen. In Bezug auf negative Aussagen über Religionen geben 62 Prozent der Befragten an, dass es an ihrer Schule Pädagog*innen gibt, die abfällig über Religionen sprechen, wobei 92 Prozent der negativen Aussagen sich auf den Islam beziehen. Fast die Hälfte der befragten Schüler*innen gibt an, dass sie in der Schule durch ihre religiöse Kleidung erkennbar sind, und fast alle von ihnen haben diesbezüglich negative Reaktionen erfahren. Insbesondere muslimische Mädchen* und junge Frauen*, die einen Hijab tragen, sind Ziel negativer Stereotype und abfälliger Bemerkungen. Im Folgenden werden einige Auszüge aus den Interviews mit Schüler*innen wiedergeben, die Einblicke in den alltäglichen Kampf gegen antimuslimischen Rassismus geben. Es kommen Mädchen*und junge Frauen* zu Wort, die einen Hijab tragen:
- „Meine Englischlehrerin appellierte in der 9. Klasse, weil ich sagte, dass ich sie nicht verstanden habe „Vielleicht solltest du dein Kopftuch ablegen, um mich besser zu verstehen“ und zeigte auf ihre Ohren.“
- „Ich wurde gefragt ob ich gezwungen wurde, an Krebs leide oder ob ich zwangsverheiratet worden bin, die Lehrer haben alle hinter meinem Rücken über mich gesprochen.“
- „Wenn ich schon so bedeckt bin, warum ich denn dann kein Kopftuch trage.“
- „Ein anderer Lehrer fragte mich vor der gesamten Klasse, ob ich noch nicht zum IS übergetreten bin.“
- „Wir sind in Deutschland“ oder „wir leben in einem europäischen Land, bedenke das!“
- „bist ziemlich undankbar, weil du trotz der Freiheiten in Deutschland, dich unterdrücken lässt.“
- „Der Schulleiter sagte, ich solle mein Kopftuch abnehmen, oder gehe ich etwa putzen.“ (alle Zitate: Yegane et al. 2021, S. 29-30)
Muslimische Mädchen* und Frauen*, und insbesondere diejenigen, die einen Hijab tragen, sind den Studien nach zu schließen, besonders von antimuslimischem Rassismus betroffen. Ihre Diskriminierungserfahrungen bilden sich aus dem Zusammenwirken unterschiedlicher Differenzlinien, wie Religion, Geschlecht, Klassenherkunft und ethnischer Herkunft. Es ist ein typisches Merkmal antimuslimischen Rassismus‘, dass neben der Religion und/oder ethnischen Herkunft oft weitere, sich miteinander potenzierende Diskriminierungslinien dazukommen.
In der folgenden Lerneinheit werden diese Wirkungsweisen näher besprochen.
„Seit einiger Zeit wird der Islam als Begründung für soziale und gesellschaftliche Probleme angeführt, sie werden kulturalisiert. Damit wird die gesellschaftliche und politische Verantwortung zurückgewiesen und effektive Interventionen verhindert. Es ist indes nicht zufällig, dass der Islam als Legitimation herangezogen wird. In der Geschichte des westlich-christlichen Bildes über den Anderen hat der Islamdiskurs immer wieder eine Rolle gespielt. Sie finden in aktuellen Diskursen Eingang und verweisen auf weiteren Interventionsbedarf.“ (Attia 2013 S. 3)
Mit antimuslimischem Rassismus werden die generelle Abwertung und Ablehnung von Muslim*innen bezeichnet. Hierbei wird eine Andersartigkeit (Othering) angenommen, welche pauschal mit negativen Eigenschaften in Verbindung gebracht wird. Muslim*innen werden beispielsweise als ungebildet, patriarchal, minderwertig und frauenverachtend konstruiert. Es ist wichtig zu betonen, dass antimuslimischer Rassismus nicht nur Muslim*innen trifft, sondern auch Menschen, die als Muslim*innen gelesen werden, z.B. aufgrund ihres Namens oder ihres Aussehens.
Antimuslimischer Rassismus
Antimuslimischer Rassismus ist eine Form des Rassismus, die sich auf Menschen richtet, die als Muslim*innen identifiziert werden, unabhängig davon, ob sie gläubig sind oder wie sie ihren Glauben praktizieren. Dieser Rassismus ist nicht nur in extremistischen Kreisen, sondern auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft weit verbreitet. Rassismus bedeutet, dass bestimmten Gruppen aufgrund ihrer ethnischen, nationalen, kulturellen oder religiösen Zugehörigkeit bestimmte Eigenschaften zugeschrieben werden, die als negativ bewertet werden. Rassismus geht oft mit einer Asymmetrie von Macht einher, die zwischen denjenigen besteht, die rassistisch handeln, und denjenigen, die davon betroffen sind. Der Begriff antimuslimischer Rassismus beschreibt die Abwertung von Muslim*innen, die von ausgrenzenden Menschen ausgeht und nicht durch den Islam gerechtfertigt ist (vgl. BAG K+R, o.J., S. 2).
Das Konzept des antimuslimischen Rassismus wurde im deutschsprachigen Raum insbesondere von Iman Attia und Yasemin Shooman beschrieben. Antimuslimischer Rassismus ist eine Strategie, gesellschaftliche Hierarchien und Machtverhältnisse zu legitimieren und zu erhalten. Antimuslimische Diskriminierung kann auf persönlicher Ebene stattfinden und ebenso als institutionelle Diskriminierung durch behördliche Abläufe, Gesetze oder durch kriminalisierende Praktiken wie „Racial Profiling“ auftreten. Antimuslimischer Rassismus zeigt sich in ungleicher Verteilung von Rechten und Teilhabechancen, aber auch in verbaler und körperlicher Gewalt. Um antimuslimischen Rassismus zu bekämpfen, ist es daher wichtig, nicht nur individuelle Vorurteile zu thematisieren, sondern auch die gesellschaftlichen Strukturen und Machtdynamiken zu hinterfragen, die diese Formen des Rassismus begünstigen.
„Antimuslimischer Rassismus (be-)trifft Menschen, die als ›Muslim:innen‹ angesprochen und ausgeschlossen, bevormundet und bemitleidet, zurückgewiesen und behindert, beschimpft und beschuldigt werden […] (Attia et al. 2021, S. 23).
Demzufolge sind Muslim*innen und Personen, die als solche wahrgenommen werden, auch in Schule- und Berufsschulkontexten betroffen. Attia und Keskinkılıç (2016) betonen, dass nicht nur auf Kenntnisnahme von Vielfalt abzielende „[i]nterreligiöse Dialoge, Islamkonferenzen, muslimischer Religionsunterricht, Islam in Curricula, Speisevorschriften und Gebetsmöglichkeiten an Schulen und in Betrieben“ (Attia & Keskinkılıç 2016, S. 169) stattfinden sollen. Ebenso sollten intersektionale Verstrickungen mit weiteren Dimensionen wie Sexismus, Klassismus, Bodyismus oder Nationalstaatenbildung mit beachtet werden (vgl. ebd.).
Antimuslimische und islamfeindliche Einstellungen sind auch heute weit verbreitet. So zeigt dies beispielsweise eine Studie des Sachverständigenrats (SVR) für Integration und Migration, als auch die Mitte Studie (Zick/ Küpper 2021). Der in der Gesellschaft verankerte Hass materialisiert sich deutlich in den Zahlen von Übergriffen und Gewalttaten gegenüber muslimischen und als muslimisch markierten Menschen (siehe Beginn der Lerneinheit). Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer wesentlich höher ist. Antimuslimischer Rassismus kann auch eine Brücke in den Rechtspopulismus/Rechtsextremismus sein: Mit antimuslimischen Ressentiments schaffen es europaweit rechtspopulistische Strömungen Anhänger*innen für sich zu gewinnen (vgl. Shooman, 2016, S. 1). Im Sicherheitsdiskurs, besonders im Diskurs um Terrorismus, werden muslimische und als muslimisch markierte Akteur*innen immer wieder „aufgrund ihrer (zugeschriebenen) Religion, Kultur und/oder Herkunft als Bedrohung [bezeichnet] und […] [ins] Visier strafrechtlicher Maßnahmen“ (Attia et al. 2021, S. 9) genommen. Auch wenn der antimuslimische Rassismus mit den Anschlägen auf die Twin Tower in Manhattan (9/11) eine neue Dimension erreichte, ist wichtig zu betonen, dass diese Form des Rassismus bis in das Ende des 15. Jahrhunderts zurückreicht (vgl. ebd. S.13). In der Kolonialzeit entstanden im europäischen Diskurs Bilder von Rückständigkeit und Gewalttätigkeit in Bezug auf muslimische und als muslimisch markierte Menschen[1]. Diese Bilder haben sich im Laufe der Geschichte von einem biologistisch definierten Rassismus hin zu einem Rassismus gewandelt, der sich eher über konstruierte kulturelle Unterschiede (Neorassismus/Kulturrassismus[2]) ergibt. Dieser Rassismus gegen (als) Muslim*innen (markierte), hat ein Misstrauen und eine Kriminalisierung zur Folge, die zu Benachteiligung, Ausschluss und Gewalt auf persönlicher, struktureller und institutioneller Ebene bis heute führt (ebd. S. 18).
Zusammenfassend ist es wichtig festzuhalten, dass eine Reaktion auf antimuslimischen Rassismus, genau wie gegen weitere Formen von Rassismus und Diskriminierung, immer aus einer rassismuskritischen und intersektionalen Perspektive heraus passieren muss (vgl. Attia et al. 2021, S. 169). Darin inbegriffen ist die Reflexion der eigenen Person, die Förderung von Empathie und Solidarität sowie die Anerkennung von Vielfalt und Differenz. Antimuslimischer Rassismus muss als eine Erfindung von antimuslimischen Menschen und bestehenden Strukturen und Prozessen verstanden werden, der sein „Feindbild“ selber produziert und welcher unabhängig von dem Verhalten muslimischer oder als muslimisch gelesener Menschen wirkt.
[1] Ausführlicher zum Zusammenhang von Rassismus und Kolonialzeit in der Lerneinheit Rassismus Grundlagen und im Glossar.
[2] Das vorherrschende Thema dieser Form von Rassismus ist nicht länger die biologische Vererbung, sondern die scheinbare Unaufhebbarkeit kultureller Unterschiede (vgl. Balibar 1990, S. 28). Dieser Rassismus kann mit Balibar gesprochen als ein „Rassismus ohne Rassen“ bezeichnet werden. Ausführlicher zum Zusammenhang von Rassismus und Kolonialzeit in der Lerneinheit Rassismus Grundlagen und im Glossar.
Um Diskriminierungserfahrungen, Anfeindungen und Gewalterfahrungen von Muslim*innen in Deutschland entgegenzutreten, braucht es Begriffe, welche diese in einem ersten Schritt beschreiben und in einem weiteren Schritt zum Ausgangspunkt für Gegenmaßnahmen werden lassen.
Vertreter*innen der kritischen Rassismusforschung (Attia 2018, Keskinkılıç 2019, Shooman 2016) folgend, plädiert dieser Beitrag für den Begriff antimuslimischer Rassismus in Abgrenzung zum Begriff der Islamophobie und der Islamfeindlichkeit. Antimuslimischer Rassismus nimmt, wie oben bereits ausgeführt, „auch politische, strukturelle und institutionelle Dimensionen in den Blick“ (Keskinkılıç, 2019, online).
Die unterschiedlichen Begriffe, von denen wir die wichtigsten im Folgenden kennenlernen werden, stehen in der wissenschaftlichen Debatte für unterschiedliche Perspektiven und Erklärungsansätze und sollten bewusst gewählt werden. Antimuslimischer Rassismus hat gewaltvolle Konsequenzen für muslimische oder als solche markierte Menschen, nicht zuletzt in Bildungsinstitutionen wie den Berufsschulen (vgl. Attia, 2018, S. 5).
„Ähnlich wie „Xenophobie“ oder „Fremdenangst/-feindlichkeit“ suggeriert der Begriff, es sei „natürlich“ oder menschlich, dass Menschen Angst vor Fremdem hätten“ (Marwa Al-Radwany 2016, S.18).
Der Begriff „Islamophobie“ wird oft verwendet, um eine ablehnende Haltung gegenüber dem Islam oder Muslim*innen zu beschreiben. Der Begriff „Phobie“ bezieht sich auf eine irrationale und unkontrollierbare Angst oder Abneigung gegenüber etwas. Heitmeyer konkretisiert diese Angst als irrationale Schaffung von stereotypen Bildern über (als) Muslim*innen (markierte) (vgl. 2012, S. 20). Zurück geht der Begriff auf die britische Anti-Rassismus-Stiftung „Runnymede Trust“. Die Stiftung definierte Islamophobie mit einer monolithischen, feindlichen, gewaltvollen und manipulativen Sicht auf den Islam. Der Islam wird in dieser Definition auch als „natürlicher“ Feind (vgl. Holloway, 2019, online) gesehen. Kritik kommt gegen das in dieser Definition vertretene Verständnis, Islamophobie sei ein „unbegründetes Vorurteil“ (Pfahl-Traughber, 2019, online). Hier werde die Definition nicht der Tatsache gerecht, dass diese Sicht in der Gesellschaft strukturell verankert ist und damit folglich über eine persönliche Eben hinweg wirkt. Besonders in der Vorurteilsforschung und im Bereich der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF) wurde diese Sichtweise weitergetragen (Heitmeyer, 2012). Es lässt sich zusammenfassend festhalten, dass die Definition des Begriffs Islamophobie verkürzt ist, da antimuslimischer Rassismus mehr als nur individuelle Angst beinhaltet (vgl. Attia & Keskinkılıç 2016, S. 16). Bei einer einseitigen Fokussierung auf das Individuelle, wird die strukturelle Dimension unsichtbar gemacht und eine tiefergehende Auseinandersetzung blockiert. Auch ist der Begriff Phobie irreführend, da antimuslimischer Rassismus keine Angststörung ist, sondern ein strukturell erzeugtes Ungleichheitsphänomen.
Anders als bei dem Begriff Islamophobie, gibt es für den Begriff Islamfeindlichkeit kaum tiefergreifende Auseinandersetzungen über Definitionen (Pfahl-Traughber 2019, online). Bei unterschiedlichen Verständnissen von Islamfeindlichkeit werden folgende Gemeinsamkeiten deutlich: Eine starke Ablehnung des Islams und seine Darstellung als Bedrohung. Besonders anschlussfähig ist dieses Verständnis für rechtspopulistische und rechtsextreme Positionen.
Ebenso wie bei Islamophobie gibt es auch gegen den Begriff Islamfeindlichkeit Kritik, da hier statt der betroffenen Muslim*innen, der Islam zum „Objekt der Diskriminierung“ (Shooman 2016, S. 8) gemacht wird. Allerdings richtet sich Feindlichkeit immer direkt an konkrete Menschen(gruppen) und trifft diese gewaltvoll. Folglich hat nicht „der Islam“ mit Diskriminierung und Gewalt zu kämpfen, sondern die als muslimisch markierten/muslimischen Menschen. Ein weiteres Problem beider Begriffe ist, dass rassistische Handlungen oder Kommentare durch das Argument, „man wolle nur „den Islam“ kritisieren“ verdeckt werden können und sich so einem Rassismusvorwurf entzogen werden kann (vgl. ebd). Diese Begriffe erschweren außerdem gleichermaßen, berechtigte und angemessene Kritik gegen den Islam zu formulieren (vgl. ebd. S. 9)[1]. In diesem Zusammenhang weisen Attia und Schooman deutlich darauf hin, dass es nie bei einer pauschalen Islamkritik bleiben darf, als dessen positives Gegenbeispiel dann oft das Christentum herangezogen werde (ebd. S. 10).
[1] „Islamkritik“ ist ein Begriff, der von verschiedenen Personen und Gruppen auf unterschiedliche Weise verwendet wird. In der Regel bezieht er sich jedoch auf die kritische Auseinandersetzung mit verschiedenen Aspekten des Islams, einschließlich der religiösen Lehren. Wichtig zu verstehen ist, dass die Religion hierbei nicht zum pauschalen Feindbild erklärt wird. (vgl. (Pfahl-Traughber, 2019, Online).
Wir haben uns in dieser Lerneinheit für den Begriff des „antimuslimischen Rassismus“ entschieden, da er sowohl die strukturelle Dimension der Diskriminierung umfasst als auch deutlich macht, dass es um die betroffen muslimisch gelesenen Menschen und nicht um die Religion an sich geht. Eine Vorstellung des Begriffs ist bereist an früherer Stelle in diesem Text erfolgt.
„Aber ich glaube, wenn wir uns klarmachen, dass es eben nichts Individuelles ist, sondern die Art, wie wir sozialisiert sind, durch Rassismus geprägt ist, dann wird es vielleicht auch etwas einfacher und dann kann man das von der Person abkoppeln und es wirklich als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstehen“ (El Sayed 2022, online).
Ein Blick in die Studien, die zu Beginn der Lerneinheit vorgestellt wurden, zeigt, dass es dringenden Handlungsbedarf für den Raum Schule und Berufsschule gibt. Im Folgenden wollen wir folglich darüber nachdenken, wie sich Antimuslimischer Rassismus in der Institution Berufsschule zeigt und was Lehrkräfte auf individueller und die Schulen auf struktureller und institutioneller Ebene dagegen tun können. Dafür werden einige Handlungsoptionen vorgestellt, die in der anschließenden Aufgabe vertieft werden können. Auch wenn wir im Folgenden über den Kontext Berufsschule nachdenken, sollte immer im Gedächtnis bleiben, dass es sich um ein gesamtgesellschaftliches Problem handelt und es Veränderungsprozesse auf unterschiedlichen Ebenen bedarf.
Antimuslimischer Rassismus stellt in Berufsschulen für viele muslimische Schüler*innen sowie für solche, die als muslimisch gelesen werden, eine alltägliche Herausforderung dar.
Er zeigt sich laut Fereidooni (2020, online) etwa in Äußerungen wie: „Junge Muslime sind aggressiv“, „Muslimische Mädchen müssen wegen ihrer Eltern Kopftuch tragen und werden später zwangsverheiratet“ oder „Muslime werden über ihre Religion zum Töten aufgefordert“.
Rassistische Stereotype, wie die eben genannten, nicht weiterzutragen erfordert von Lehrkräften ein hohes Maß an Differenzsensibilität und Selbstreflexion. Vorweg sollte an dieser Stelle betont werden, dass Lehrkräfte in Schulen bereits viel leisten und es sich herausfordernd anfühlen kann, weitere Themen in den Lehrplan zu implementieren. Da Themen wie antimuslimischer Rassismus und andere Formen von Rassismus, Sexismus, Klassismus oder Ableismus immer eine Rolle spielen, ist ein Blick darauf jedoch unabdingbar. Durch eine Reduktion von Ungleichbehandlung und Diskriminierung verbessert sich das Schulklima nachhaltig und sorgt im Umkehrschluss für ein besseres Arbeitsklima insgesamt.
Es gibt Handlungsmöglichkeiten, die ganz praktisch daran ansetzen, antimuslimischen Rassismus und weiter Formen von Rassismus in der Schule zu begegnen und etwas entgegenzustellen.
Hierfür werden wir uns an den Vorschlägen der Politikwissenschaftlerin, Fatima El Sayed, orientieren, die einen Fokus auf kritische Migrations- und Integrationsforschung setzt. Die folgenden Handlungsmöglichkeiten erheben keinesfalls den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern sollen zum Weiterdenken anregen. Handlungsleitend ist die Frage, wie Lehrkräfte konkret gegen antimuslimischen Rassismus vorgehen können.
Generell plädiert El Sayed (2022) für einen stärkeren Einbezug zivilgesellschaftlicher Akteur*innen in den Raum (Berufs)Schule, da diese spezifischen Kenntnisse und Fertigkeiten mitbringen und Zeit haben sich mit diesen Themen zu befassen. Insbesondere können so regelmäßig Empowerment- oder Beratungsangebote bereitgestellt werden.
Bevor es um konkrete Handlungen geht, betont El Sayed (ebd.), wie in der rassismuskritischen Professionalisierung generell, die Reflexion des eigenen Standpunkts:
- Sensibilisieren: Lehrkräfte sollten sich bewusst sein, dass ihr Wissen und ihre Wahrnehmungen von antimuslimischem Rassismus und anderen Formen von Rassismus geprägt sind. Lehrkräfte sollten sich darüber im Klaren sein, welche Rolle sie im Klassenraum einnehmen, wie Schüler*innen auf sie reagieren und in welcher Machtposition sie sich befinden. Dem Handeln sollte also Erkenntnis vorrausgehen. Hierein fällt ebenso die Auseinandersetzung mit angemessener, keinesfalls antimuslimischen Rassismus reproduzierender, Fachliteratur.
- Raum für die Thematik schaffen: Nachdem eine erste Sensibilisierung angestoßen wurde, sollte das Thema aktiv im Klassenraum und in der Schule sichtbar werden. Sei es durch gestalterische Veränderungen des Klassenraums, durch Projekttage oder durch die Erweiterung/kritische Überarbeitung der Unterrichtsthemen.
- Beschwerdestellen einrichten: Das erste Problem ist oft, dass Schüler*innen, die von antimuslimischem Rassismus betroffen sind, nicht wissen, an wen sie sich wenden können. Hierfür ist die Einrichtung unabhängiger und handlungsbefugter Beschwerdestellen ein wichtiger Schritt.
- Aus- und Weiterbildung: Es ist sinnvoll bereits in der Ausbildung von Lehrkräften mehr zu Rassismen, Differenzsensibilität und Diversität zu lernen und Möglichkeiten an der Schule zu implementieren, regelmäßige Fortbildungen wahrnehmbar zu machen.
- Institutionelle Verankerung: Für eine weitreichende Veränderung festgefahrener Strukturen braucht es die Zusammenarbeit aller Beteiligten an Schule. Hier ist im besonderen Maße die Leitungsebene gefragt Strukturveränderungen anzustoßen und Ressourcen bereitzustellen, sei es im Bereich Personal oder Budget.
- Förderung von Mehrsprachigkeit: Die Mehrheit der muslimischen Schüler*innen oder solcher, die als solche markiert werden, spricht neben Deutsch eine zweite Sprache oder eine zweite Muttersprache. Oft sind es Arabisch, Türkisch oder Kurdisch. Diese Sprachen werden im deutschen Kontext oft nicht ausreichend anerkannt[1]. Es ist allerdings wichtig, dass Berufsschulen sich für eine höhere Anerkennung weiterer Sprachen als Deutsch, in schulischen und gesamtgesellschaftlichen Kontexten einsetzen.
Wie genau sich die Handlungsmöglichkeiten konkret umsetzen lassen, ist von Berufsschule zu Berufsschule anders und muss an den jeweiligen Voraussetzungen und Ausgangspositionen anknüpfen. Insgesamt ist eine Öffnung hin zu mehr Diversität, Sensibilität und Inklusion notwendig.
[1] Mehr zum Thema Sprachhierarchien und Sprechverbote in dem Modul Neo-Linguizismus.
Beschreiben Sie ein (eigenes) Ereignis, an dem Sie sich mit antimuslimischem Rassismus schon einmal auseinander setzen musst.
Entweder, weil sie ein solches beobachtet haben, selbst involviert waren oder in den Medien davon mitbekommen haben. Beschreiben Sie analytisch-theoretisch unter Bezug auf den gelesenen Text, warum Sie dieses Ereignis als antimuslimischen Rassismus einordnen würden und welche Möglichkeiten der Intervention Sie in der Rolle einer*s Lehrer*in hätten.
Überlegen Sie bitte anhand der eben vorgestellten Handlungsmöglichkeiten, oder darüber hinaus, wo Sie ansetzen würden, um gegen antimuslimischen Rassismus in Ihrer (zukünftigen) Schule vorzugehen. Recherchieren Sie mit Hilfe der weiterführenden Literatur und entwerfen Sie eine ca. einseitige Skizze, die Ihre Ideen und Ihr Vorhaben für unbeteiligte Dritte verständlich macht. (Sorgen Sie für eine einladende Gestaltung: Schreiben Sie im Fließtext, nutzen Sie gern auch Grafiken, Methodenvorschlägen etc.). Vergessen Sie bitte nicht, sorgfältig ihre Quellen zu belegen.
- At Radwany, Marwa (2016). „Rassismus ist kein individuelles Problem“ Interview mit Marwa Al-Radwany zu Begriff und Geschichte des Antimuslimischen Rassismus, aktuellen Feindbildern und Auswirkungen auf Betroffene. In: Landeskoordinierungsstelle Demokratiezentrum Baden-Württemberg (Hg Pädagogischer Umgang mit Antimuslimischem Rassismus. Ein Beitrag zur Prävention der Radikalisierung von Jugendlichen.): https://www.lpb-bw.de/fileadmin/lpb_hauptportal/pdf/publikationen/antimuslim_rassismus.pdf. [letzter Zugriff 02.03.2023].
- Attia, Iman (2013). Privilegien sichern, nationale Identität revitalisieren. Gesellschafts- und handlungstheoretische Dimensionen der Theorie des antimuslimischen Rassismus im Unterschied zu Modellen von Islamophobie und Islamfeindlichkeit. In: Journal für Psychologie 21, Ausgabe 1, http://www.journal-fuer-psychologie.de/index.php/jfp/article/view/258/297. [letzter Zugriff 02.03.2023].
- Attia, Iman/ Keskinkılıç, Ozan Zakariya (2016). Antimuslimischer Rassismus. In. Paul Mecheril (Hg.): Handbuch Migrationspädagogik. Wiesbaden: Springer. S. 168-182
- Attia, Iman (2018): Die fremdgemachte Gewalt. Zum Verhältnis von antimuslimischem Rassismus, dem Bedrohungsszenario des ‚islamistischen Terrorismus‘ und Extremismusprävention. Online: https://praeventionsnetzwerk.org/wp-content/uploads/2019/11/Debattenbeitrag-I.-Attia-Die-fremdgemachte-Gewalt.pdf [letzter Zugriff 02.03.2023].
- Attia, Iman/ Keskinkılıç, Ozan Zakariya/ Okcu, Büşra (2021). Muslimischsein im Sicherheitsdiskurs: Bielefeld: transcript.
- BAG K+R (Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche+ Rechtsextremismus) (o.J.). 5 Fragen zum
- Antimuslimischen Rassismus. Online Vielfalt Mediathek: https://www.vielfalt-mediathek.de/wp-content/uploads/2020/12/bag_kr_4_antimuslimischerrassismus_vielfalt_mediathek.pdf. [letzter Zugriff 02.03.2023].
- Bundeskriminalamt (2022). Politisch motivierte Kriminalität im Jahr 2021. Online: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/2022/pmk2021-factsheets.pdf?__blob=publicationFile&v=2. [letzter Zugriff 06.03.2023].
- Fereidooni, Karim (2020). Islam im Kontext Schule. Online: https://www.multikulti-forum.de/de/news/islam-im-kontext-schule. . [letzter Zugriff 01.03.2023].
- Giordono-Scholz, Meike (2022). Weit verbreitet? SVR-Studie zu antimuslimischen und antisemitischen Einstellungen in Deutschland. Online: https://idw-online.de/de/news802380. . [letzter Zugriff 06.03.2023].
- Heitmeyer, Wilhelm (2012): Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (GMF) in einem entsicherten Jahrzehnt, in: Heitmeyer, Wilhelm (Hrsg.): Deutsche Zustände, Folge 10, Berlin, S. 15–41.
- Holoway, Lester (2016). Islamophobia – 20 Years on, still a challenge for us all. Runimedetrust, Online: https://www.runnymedetrust.org/blog/islamophobia-20-years-on-still-a-challenge-for-us-all. [letzter Zugriff 28.03.2023].
- Keskinkılıç, Ozan Zakariya (2019). Was ist antimuslimischer Rassismus? bpb Online: https://www.bpb.de/themen/infodienst/302514/was-ist-antimuslimischer-rassismus/. [letzter Zugriff 07.03.2023].
- Mediendienst Integration (2021). Infopapier Antimuslimischer Rassismus in Deutschland: Zahlen und Fakten. Online: https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/Infopapier_Antimuslimischer_Rassismus.pdf. [letzter Zugriff 29.03.2023].
- Pfahl-Traughber, Armin (2016). Islamfeindlichkeit, Islamophobie, Islamkritik – ein Wegweiser durch den Begriffsdschungel. bpb Online: https://www.bpb.de/themen/rechtsextremismus/dossier-rechtsextremismus/180774/islamfeindlichkeit-islamophobie-islamkritik-ein-wegweiser-durch-den-begriffsdschungel/. [letzter Zugriff 27.03.2023].
- El Sayed, Fatima (2022). Was tun gegen antimuslimischen Rassismus im Klassenzimmer? – Webtalk mit Fatima El Sayed. Interview Ufuq Online: https://www.ufuq.de/aktuelles/was-tun-gegen-antimuslimischen-rassismus-im-klassenzimmer-webtalk-mit-fatima-el-sayed/. [letzter Zugriff 29.03.2023].
- Shooman, Yasemin (2016). Antimuslimischer Rassismus – Ursachen und Erscheinungsformen. Informations- und Dokumentationszentrum für Antirassismusarbeit e. V. (IDA) (Hg.). Düsseldorf: Vielfaltmediathek.
- Shooman, Yasemin (2014): »… weil ihre Kultur so ist«: Narrative des antimuslimischen Rassismus, Bielefeld: transcript Verlag.
- Yegane, Aliyeh Arani (2015). Antimuslimische Einstellungen und Diskriminierungsrealität an deutschen Schulen. In: Christian Pfeffer-Hoffmann, Michail Logvinov (Hg.): Muslimfeindlichkeit und Migration: Thesen und Fragen zur Muslimfeindlichkeit unter Eingewanderten, Minor, Projekt Wir Hier! Berlin: Mensch und Buch. S. 108-120.
- Yegane, Aliyeh & Willems, Joachim, Moir, Joachim (2021). Religion und Glauben an der Schule. Diskriminierungserfahrungen muslimischer Jugendlicher in Berliner Schulen. Herausgegeben von ADAS/ LIFE Bildung, Umwelt, Chancengleichheit e.V.
- Andreas Zick/ Beate Küpper (2021). Die geforderte Mitte Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2020/21. Berlin: Dietz.
Titel | Inhalt | Weblink |
Was tun gegen antimuslimischen Rassismus im Klassenzimmer? – Webtalk mit Fatima El Sayed | In dem Interview erklärt die Wissenschaftlerin Fatima El Sayed, wie sich antimuslimischer Rassismus in der Institution Schule zeigt und bietet Lehrkräften und Schulen auf unterschiedlichen Ebene Handlungsoptionen an. | |
| Hass-im-Netz ist eine Meldestelle bei Onlinehetze und informiert in diesem Zusammenhang über antimuslimischen Rassismus im Internet. | |
Pädagogik, politische Bildung und Prävention in der Migrationsgesellschaft
| Gute Übersicht zu antimuslimischem Rassismus und weiteren Diskriminierungslinie. | |
Antimuslimischer Rassismus erklärt – Interview und Analyse mit Prof.in Iman Attia
| Öczan Karadeniz (Verband binationaler Familien und Partnerschaften) im Gespräch mit Prof. Dr. Iman Attia (Alice Salomon Hochschule Berlin) zum Thema antimuslimischer Rassismus (2016) | |
Antimuslimischer Rassismus und islamistische Onlinepropaganda
| Antimuslimischer Rassismus bis hin zu rechtsextremer Onlinepropaganda ist im Netz allgegenwärtig. Doch auch islamistische Akteure instrumentalisieren islamfeindliche Äußerungen und Handlungen, um im Netz massiv zu mobilisieren. Das wiederum nutzen Rechtsextreme für ihre Agenda: Eine verhängnisvolle Wechselseitigkeit. | |
Gemeinsam gegen | Handreichung und Materialsammlung antimuslimischer Rassismus in Schule | https://www.vielfalt-mediathek.de/wp-content/uploads/2021/02/ZEOK_KNW_Broschuere_Web.pdf |
Sie lesen lieber ein Buch?
Über die folgenden Schaltfläche kommen sie zu unserem OER-Buch: