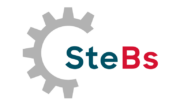Modul 5 |
Rassismus – Grundlagen
Rassismus – Grundlagen
In dieser Lerneinheit zum Thema „Rassismus“ geht es darum, sich dem Thema zunächst sehr grundlegend anzunähern. Dazu lernen Sie entlang eines Fallbeispiels insbesondere den Ansatz des Kulturrassismus theoretisch zu verorten und damit Ihren pädagogischen Blick für kulturrassistische Zuschreibungen zu schärfen. Im Anschluss an den Text finden Sie die Aufgabenstellungen zu dieser Lehreinheit.
- Einstieg
- Theorie
- Aufgabe & Reflexion
In diesem Fallbeispiel aus einer Unterrichtsstunde an einer Berufsschule in Norddeutschland finden Sie Praxen (Lehrer:innenhandeln), die im Folgenden mit dem Ansatz des „Kulturrassismus“ verknüpft und theoretisch verortet werden. Ziel ist es, Kulturrassismus als solchen zu erkennen und alternative Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.
Ein Frühlingstag im Jahr 2020, Unterrichtsbeginn: 10:00 Uhr. Frau Scholz (weiß, deutsch, weiblich, 39 Jahre alt) arbeitet mit Schüler:innen der Kfz-Vorbereitungsklasse einer Berufsbildenden Schule im Fach Mathematik. Es sind circa 30 Schüler:innen anwesend. Die meisten Schüler:innen sitzen bereits ein paar Minuten vor Beginn der Stunde an ihren Plätzen und unterhalten sich leise. Die Lehrperson, Frau Scholz, steht vor der Klasse zwischen Tafel und ihrem Schreibtisch und schaut abwechselnd nach draußen auf den Schulhof und auf die Tür. Der Schulgong erklingt, Frau Scholz schließt die Tür und geht zurück nach vorne, die Gespräche verstummen. Direkt nach ihrer Begrüßung geht die Klassentür nochmal auf und ein Junge eilt hinein. Frau Scholz schaut ihn an und sagt mit einem strengen, aber doch freundlichen Gesichtsausdruck: „Guten Morgen, Mohammed. Die Uhren in der Türkei ticken vielleicht anders, aber hier hat die Stunde vor fünf Minuten begonnen.“
Mit dem beschriebenen Fallbeispiel, welches an einer Berufsschule in Norddeutschland von uns in ähnlicher Form beobachtet wurde (Namen und Unterrichtssetting sind umbenannt), wird die Vorstellung einer „anderen“ Zeitlichkeit/einer „anderen“ Kultur für eine pädagogische Ansprache genutzt und der Schüler damit a) als Türke adressiert, b) als jemand, der sich einer anderen Kultur zugehörig fühlt, c) als eine Person, die nicht von „hier“ kommt, und wird d) dabei abgewertet als eine Person, die sich abweichend und nicht der Norm entsprechend verhält.
In dieser zunächst recht harmlos erscheinenden Ansprache von Mohammed stecken also viele Sprachhandlungen gleichzeitig – und es ist interessant, dem genauer auf die Spur zu gehen.
In pädagogischen Settings und Institutionen sind Lehrende täglich aufgefordert, sich zu Heterogenität und Differenz zu verhalten. Wie schon in den ersten beiden Kapiteln beschrieben, ist auch das Denken, Handeln und Sprechen von Lehrenden von den Differenzordnungen und Machtverhältnissen bestimmt, in denen sie sich bewegen. Rassistische Denkmuster, die schon seit der Kolonialzeit und damit seit über 500 Jahren ihre Wirkmacht entfalten, sind tief eingeschrieben und oftmals schon so „normalisiert“, dass wir sie gar nicht mehr als Rassismus erkennen.
Es gibt sehr viele Facetten des Rassismus, über die wir nachdenken könnten. Im Kontext dieser Lerneinheit soll der Schwerpunkt jedoch auf drei Punkten liegen, die im Kontext von pädagogischen Räumen besonders wichtig sind:
1. White Supremacy
2. Zivilisierungsmission
3. Epistemische Gewalt
Der erste Punkt, White Supremacy, lässt sich am besten mit „Weißer Übermacht“ übersetzen. Während der Kolonialzeit und bis heute wurden Menschen, die als weiß galten, jenen Menschen als überlegen gegenübergestellt, die als nicht-weiß galten. Wer als weiß galt, änderte sich im Laufe der Jahrhunderte immer wieder mal und ist auch heute noch umstritten, wenn wir uns beispielsweise mit antislawischem Rassismus beschäftigen, der sich gegen osteuropäische „weiße“ Menschen richtet. Interessant ist, dass weiße Menschen zu keinem Zeitpunkt wirklich aufgrund ihrer Hautfarbe „überlegen“ waren, aber durch den Einsatz von Waffen, brutaler Gewalt und den globalisierten Kapitalismus eine faktische Hegemonie über einen großen Teil der Welt erreicht haben und bis heute noch weitgehend halten (vgl. Heinemann & Akbaba, 2023). Hegemonial sein bedeutet, dass es möglich ist, den Standard zu setzen und alles andere daran entlang als abweichend zum Standard zu markieren. Frau Scholz spricht Mohammed auf eine Weise an, die deutlich macht, dass sie davon ausgeht, dass in der Türkei ein anderes Zeitverständnis herrschen würde. Ein anderes als der von ihr „hier“ gesetzte Standard.
Der zweite Punkt, Zivilisierungsmission, bezieht sich auf die während der Kolonialzeit genutzte Begründung, dass es notwendig sei, Menschen aus dem globalen Süden zu „Gott“ zu führen und zu zivilisieren, weil diese angeblich nicht so zivilisiert seien wie die Europäer:innen und ohne den christlichen Gott nicht erlöst werden könnten. Mit dieser Begründung – auch Legitimationslegende genannt – wurde erklärt, warum es angeblich notwendig war, dass weiße Menschen nicht-weiße Menschen beherrschten. Dies sei nur zu ihrem Guten. Auch wenn uns diese Begründung aus heutiger Sicht absurd scheint, wird sie in ähnlicher Weise auch heute noch genutzt, wenn davon gesprochen wird, dass „andere Kulturen“ nicht so pünktlich, ordentlich, rational, effizient, modern etc. seien wie die „westliche“. Auch die freundliche, strenge Ansprache von Frau Scholz beinhaltet den Impuls der „Zivilisierung“. Während dies einerseits im pädagogischen Kontext ja völlig „normal“ ist, dass wir auch erzieherisch auf unsere Schüler:innen einwirken, ist hier die Problematik, dass Frau Scholz sprachlich eine Verbindung mit einer unterstellten Zugehörigkeit zur Türkei und zu einer „anderen“ Kultur herstellt. Sie hätte alternativ sagen können: „Guten Morgen, Mohammed. Magst du mir (am Ende der Stunde) erzählen, warum du dich verspätet hast?“ Und hätte dann vielleicht davon erfahren, dass es einen Unfall auf der Straßenbahnlinie gab. So erfährt Frau Scholz a) den Grund für die Verspätung und signalisiert b), dass es ihr wichtig ist, dass alle pünktlich im Raum sind, wenn die Stunde beginnt.
Der dritte Punkt, epistemische Gewalt, bezieht sich auf Gewalt, die im Bereich der Wissensproduktion entsteht, und ist dadurch für pädagogische Räume besonders relevant. Während der Kolonialzeit wurde machtvoll durchgesetzt, dass nur „westliches“ Wissen als wissenschaftliches, wahres, faktisches Wissen gilt und alle anderen Wissensformen als spirituell, Aberglaube, weniger wert, unwichtig etc. (vgl. weiterführend Sousa Santos, 2016). Dies zeigt sich heute zum Beispiel darin, dass Migrationssprachen im Klassenraum weniger wert sind als Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch (die Kolonialsprachen) oder darin, dass nur bestimmte Wissensinhalte, Personen, Erzählungen im Kontext Schule Platz haben, während andere systematisch ausgeblendet bleiben. So kennen wir alle beispielsweise den Namen Christoph Kolumbus, dessen Taten zudem als ruhmreiche „Entdeckungen“ vermittelt werden, während gleichzeitig die Leidensgeschichten der indigenen Bevölkerungen ausgeblendet werden und wir von den damals dort lebenden indigenen Menschen weder Namen noch Biografien kennen. Diese Ausblendungen führen dann zu dem, was im Rahmen postkolonialer Theorieansätze als „gestattete Ignoranz“ bezeichnet wird. Es ist nicht „gestattet“, die Hauptstadt von Frankreich nicht zu kennen. Aber wenn eine:r die Hauptstadt von Kenia nicht kennt, scheint dieses Nichtwissen „legitim“. In unserem Fallbeispiel interessiert sich Frau Scholz gar nicht für die Perspektive von Mohammed. Vielleicht hätte sie etwas über ihn und seine Situation gelernt, wenn sie ihm zugehört hätte. Vielleicht hat er eine kleine Schwester/eine Tochter, die er zur Kita bringen muss, bevor er zur Schule kommen kann, vielleicht gibt es Probleme mit der Verkehrsverbindung, vielleicht hat er letzte Nacht nur wenig schlafen können, weil ihn traurige Ereignisse beschäftigen, oder oder… Ohne Mohammed zumindest eine Chance zu geben und seiner Stimme ernsthaft Gehör zu schenken, nimmt sich Frau Scholz selbst die Möglich- keit zu lernen und eine tragende Lehrer:in-Schüler:in-Beziehung zu gestalten.
Menschen erleben in Deutschland täglich Rassismus. Oft zeigt sich dieser nur subtil, ist also nicht direkt als solcher erkennbar. Ein Teil rassistischer Praxen lässt sich mit Hilfe der drei hier beschriebenen Theoriekonzepte leichter als solche erkennen. Dabei zeigen sie sich auf sehr unterschiedliche Art und Weise, in unterschiedlicher Intensität und Ausprägung. Die Formen reichen von Alltagsdiskriminierung über rechte Hetze im Netz bis hin zu rassistischen Gewalttaten. Die Kriminalstatistik des Bundesministeriums des Innern zeigt einen deutlichen Anstieg politisch recht motivierter Straftaten (BMI, 21.05.2024).
Anhand des Fallbeispiels lässt sich noch ein weiterer Aspekt genauer erläutern, nämlich der „kulturelle Rassismus“. Das anhand des Fallbeispiels skizzierte Problem entsteht im Prozess durch die von Frau Scholz vorgenommene Ansprache, die implizit die Botschaft vermittelt: „Du kommst zu spät, weil du der türkischen Kultur angehörst.“ Diese Form von Rassismus, die sich nicht mehr ausschließlich am „biologischen“ und/oder am „Aussehen“, sondern an der vermeintlichen Sprache und Kultur von Menschen entlang orientiert, wurde von Etienne Balibar (2017, S. 31) als „Rassismus ohne Rassen“ und von Stuart Hall (2022 [2000]) als „Kulturrassismus“ bezeichnet. Hall beobachtet diese Form von Rassismus, die sich in den 1950er-Jahren mit den sogenannten „Gastarbeitern“ aus der Karibik und dem indischen Subkontinent in England entwickelte, und führt dazu aus:
„In der nachkolonialen Periode findet man den genetischen Rassismus nicht mehr so häufig, üblich ist jetzt der kulturelle Rassismus […]. Der Unterschied zwischen genetischem und kulturellem Rassismus ist folgender: Die Engländer behaupten nicht, dass wir kleinere Gehirne haben, aber sie glauben, dass unsere Fähigkeiten rational zu denken, nicht so entwickelt sind.“ (Hall, 2022 [2000], S. 10 f.).
Kulturrassismus funktioniert also dadurch, dass vermeintlich „Anderen“ zugeschrieben wird, eine „andere Kultur“, andere Fähigkeiten, eine andere Mentalität zu haben, die sich von den Eigenschaften des „Wir“ oder der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden würden. Dabei wird dieses „Anderssein“ nicht nur neutral beschrieben, sondern im Vergleich zur „eigenen“ (deutschen) Kultur abgewertet.
Frau Scholz’ Aussagen lassen sich vor diesem Hintergrund als bewusste oder unbewusste Reproduktionen von spezifischen gesellschaftlichen Ordnungen verstehen, die von Ungleichheitsverhältnissen durchzogen sind. „Es entsteht etwas“, so Hall, „was ich als rassistisches Klassifikationssystem beschreiben möchte, ein Klassifikationssystem, das auf rassistischen Charakteristika beruht.“ (Hall, 2022 [2000], S. 7). Dieses Klassifikationssystem ist insofern rassistisch, als dass es bestimmten Gruppen konstruierte, kulturelle Charakteristika zuschreibt. Das Klassifikationssystem wird ge- nutzt, um sich selbst und das, was als „eigene“ Kultur konstruiert wird, von den „Anderen“ zu trennen und abzugrenzen.
Kultur als Klassifikationssystem versammelt so verschiedene Differenzmarker, um funktionstüchtig zu sein: Unterschiede werden durch Hautfarbe und Haarfarbe, Gewohnheiten, Religion, Familien, Verhaltensweisen und das Wertesystem konstruiert und diskursiv verfestigt. Dabei werden kulturelle und soziale Marker als „natürliche“ Eigenschaften dargestellt (ebd., S. 7). Stuart Hall beschreibt diese Vorgänge also als Formen der Naturalisierung. Beispiele für die Naturalisierung von Differenz, wie sie uns häufig begegnen, sind klischeehafte Zuschreibungen wie: Südeuropäer:innen sind temperamentvoll, Nordeuropäer:innen sind kühl und distanziert, Frauen sind zu emotional für die Führungsebene. Der Philosoph Etienne Balibar gilt neben Stuart Hall als grundlegende Referenz im Kontext des „Kulturrassismus“ und erläutert den Ersatz des Begriffs „Rasse“ mit dem Begriff Kultur. Die Funktion der Abgrenzung und Abwertung, die zuvor der „Rasse“-Begriff erfüllt hat, wird nun von dem Kultur-Begriff übernommen und ersetzt. Es lässt sich eine „enge semantisch-funktionale Verbindung von Rasse und Kultur“ (Höhne, 2001, S. 201) beschreiben, die es ermöglicht, dass die Vorstellung von hierarchischen Unterschieden zwischen Menschen aufgrund von äußeren (physischen) Merkmalen erhalten bleibt. Balibar erkennt hier anstelle eines rassischen Determinismus [1] einen kulturellen Determinismus, der „nicht mehr die Überlegenheit bestimmter Gruppen oder Völker über andere postuliert, sondern sich darauf beschränkt, die Schädlichkeit jeder Grenzverwischung und die Unvereinbarkeit der Lebensweisen und Traditionen zu behaupten“ (Balibar, 2017, S. 28). Gleichzeitig geht es nicht darum, Differenzen zu negieren und so zu tun, als gäbe es keine Unterschiede zwischen Menschen. Problematisch wird es nur, wenn diese Unterschiede „unterstellt“ werden und mit der Unterscheidung Abwertungen verbunden sind. Grundsätzlich ist die Anerkennung dessen, dass in Klassenräumen der Berufsschule auch Menschen sitzen, die unterschiedliche Migrationserfahrungen gemacht haben, unterschiedliche Sprachen sprechen und vielleicht auch in verschiedenen Kulturen sozialisiert wurden, für das pädagogische Handeln wichtig. Nur so können diese Aspekte auch Berücksichtigung finden und beispielsweise Klausuren nicht während des Ramadans geschrieben oder Klassenausflüge nicht über Chanukka geplant werden.
Fußnote
[1] Determinismus bedeutet hier, dass es einen zwingenden Zusammenhang gibt, sodass alles Geschehen bzw. Handeln vorbestimmt scheint.
Gleichzeitig braucht es ein kritisches Bewusstsein dafür, dass eine Anerkennung der „Anderen“ als „Migrationsandere“ rassialisierende Folgen haben kann. Diese zeigen sich beispielsweise, wenn im Rahmen von sogenannten interkulturellen Veranstaltungen Schüler:innen dazu aufgefordert werden, Musik und Essen aus „ihren“ Heimatländern mitzubringen – auch dann, wenn sie schon in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Diesen Schüler:innen wird dadurch nicht nur die Option genommen, Deutschland als ihr Heimatland wahrzunehmen, es wird außerdem das Bild verfestigt, dass sie einer anderen Kultur zugehörig seien. Gleichzeitig kann es für manche Schüler:innen, die real eine eigene Migrationsgeschichte haben, auch die Möglichkeit eröffnen, andere zu ihrem Alltag gehörende Aspekte mit der Klasse zu teilen. Hier sollten Zuschreibungen daher mit viel Sensibilität für die reale Situation im Klassenzimmer getätigt werden. Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie lieber, statt Schüler:innen aufgrund ihres Äußeren oder ihrer Herkunft bestimmte Vorlieben, Haltungen, Men- talitäten etc. zu unterstellen.
Ansätze, wie von Stuart Hall oder Etienne Balibar (die den Cultural Studies und der postkolonialen Theoriebildung zugeordnet werden), haben in den Erziehungswissenschaften bis jetzt:
„[…] spärlich Einzug gehalten […], was umso verwunderlicher ist, als einige thematische Schwerpunkte der postkolonialen Wissenschaftskritik Grundlagen und Aufgaben der Erziehungswissenschaften zutiefst berühren. Die Problematisierung von Identität, der Umgang mit vielfältigen sozial konstruierten Differenzen, die Repräsentation der Anderen und die Konstruktion von Normalität sind zentrale Fragestellungen, die eine erhebliche Bedeutung für die Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Theoriebildung als auch für das pädagogische Handeln beinhalten.“ (Baquero Torres, 2012, S. 315).
Denken wir an das Fallbeispiel von Frau Scholz zurück, so wird deutlich, dass vielfach ein vereinfachender, diffuser und ausgrenzender Kulturbegriff als Erklärungshorizont für pädagogisches Handeln fungiert und diskriminierendes pädagogisches Handeln der Lehrenden legitimiert (bewusst oder unbewusst).
Analyse und Erarbeiten von alternativen Handlungsoptionen im Umgang mit Heterogenität
Lesen Sie sich das Fallbeispiel zu Beginn des Textes nochmals sorgfältig durch.
Zur Vertiefung Ihrer Auseinandersetzung mit Grundlagen des Rassismus ist es am einfachsten, Sie hören sich einen Podcast an.
Dazu haben Sie im Folgenden zwei zur Auswahl:
Entweder den Podcast „Rassismuskritik in der Schule“ mit Prof. Dr. Karim Ferei- dooni. Bringen Sie nach dem Hören die theoretischen Grundlagen aus diesem Modul mit den Inhalten des Interviews mit Fereidooni schriftlich zusammen. Ergänzen Sie ein paar Zeilen dazu, welche neuen zusätzlichen Erkenntnisse Ihnen das Hören gebracht hat. Sie finden ihn unter diesem Link: https://www.pse.rub.de/in sidepse-mit-prof-dr-karim-fereidooni/
Oder hören Sie das Audio von Alice Hasters (2019): Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. München: hanserblau (auf Spotify: Teil 3–8). Bringen Sie anschließend die theoretischen Grundlagen aus diesem Modul mit dem Text von Hasters schriftlich zusammen und schreiben Sie ein paar Zeilen dazu, welche neuen zusätzlichen Erkenntnisse Ihnen das Hören des Audios gebracht hat. Sie finden es unter diesem Link: https://open.spotify.com/intl-de/al bum/0FhTAyG7izSGUi7x8xaPgm
Sie lesen lieber ein Buch?
Über die folgenden Schaltfläche kommen sie zu unserem OER-Buch: