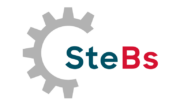Modul 3 |
Intersektionalität und Diskriminierung
Intersektionalität und Diskriminierung
In dieser Lerneinheit geht es um das Thema „Intersektionalität und Diskriminierung“. Mit einer intersektionalen Perspektive lassen sich soziale Ungleichheiten, Diskriminierungen und Privilegien in ihrer Verschränkung erkennen, benennen und analysieren. Ein intersektionaler Blick ist wichtig, um Diskriminierung nicht nur einseitig, sondern aus verschiedenen Perspektiven heraus analysieren zu können. Anhand eines Fallbeispiels wird in das Thema Intersektionalität, also die Wechselwirkung von Diskriminierungslinien wie class, race und gender, eingeführt. Anschließend wird der Intersektionalitätsansatz näher ausgeführt und als Analysewerkzeug für Diskriminierung vorgestellt. In diesem Zusammenhang werden auch wichtige Differenzlinien eingeführt. Am Ende der Lerneinheit stehen Aufgaben bereit, die dazu einladen sollen, sich dem Thema auf persönlicher sowie struktureller Ebene weiter anzunähern.
- Einstieg
- Theorie
- Aufgaben & Reflexion
In dieser Einheit steigen wir mit einem Beispiel aus der Netflix-Serie „Sex Education“ ein [1]. Sex Education erzählt aus dem (Schul-)Alltag von diversen Schüler:innen einer weiterführenden Schule in England. Hierbei thematisiert die Serie unterschiedliche Positionen im Spektrum männlich, weiblich, nicht-binär, queer etc. Diversität wird da- durch dargestellt, dass Themen wie Homosexualität, Klassenbeziehungen und Geschlechterrollen, Gender-Fluidität, Asexualität, psychische Gesundheit und Behinderungen, Herkunft und Ethnie nicht mehr als außergewöhnlich verhandelt, exotisiert oder besonders betont werden, sondern „einfach“ in ihrer Komplexität und Vielschichtigkeit erzählt werden. Des Weiteren werden Stereotype aufgebrochen und eine Vielzahl unterschiedlicher Positionen (Positionierungen) repräsentiert.
Eine der Hauptrollen in der Serie spielt die Schwarze [2] queere Person Eric. Eric kommt aus einer nigerianischen Arbeiter:innenfamilie und kann eher als genderfluid gelesen werden. Es werden lesbische, schwule und bisexuelle Personen mit verschiedensten ethnischen und sozialen Herkünften dargestellt [3]. Im Folgenden soll anhand einer Szene aus der ersten Staffel (Folge 5) aufgezeigt werden, inwiefern Intersektionalität zu einer Potenzierung von Ungleichheit und Ungerechtigkeit beiträgt. Denn auch wenn die Serie insgesamt einen eher progressiven Umgang mit Differenzen zeigt, bedeutet dies nicht, dass die Protagonist:innen in einer idealen, diskriminierungsfreien Welt leben.
Fußnoten
[1] Eine Unabhängigkeit von Streaming-Portalen ist uns wichtig. Daher haben wir durch die Darstellung und die Erläuterung des Beispiels darauf geachtet, dass es inhaltlich auch für Personen nachvollziehbar ist, welche die Serie nicht gesehen haben.
[2] Der Begriff Schwarz ist eine Selbstbezeichnung und kommt aus der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Wir schreiben den Begriff bewusst groß, um damit in Erinnerung zu rufen, dass Schwarz-Sein nicht als ein biologisches, sondern als ein soziales Konstrukt zu verstehen ist. Ebenso schreiben wir den Begriff weiß kursiv und klein um auf dasselbe hinzuweisen. Wichtig zu unterscheiden ist, dass nur Schwarz großgeschrieben wird, da es sich um eine politische Kategorie der Selbstermächtigung handelt.
[3] Für weitere Einblicke in die Serie, hier ein Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=pdcVWP9ok_U
Otis überrascht Eric mit Eintrittskarten für das Musical „Hedwig and the Angry Inch“[1]. Die Freunde stylen sich zu diesem Anlass als Dragqueens, doch als Otis den Bus zur Show verpasst, beschließt der groß gewachsene Schwarze Eric, allein loszufahren. Eric trägt High Heels und eine Perücke, ist geschminkt und reist allein. Später werden sein Handy und seine Brieftasche gestohlen und er ist gezwungen, allein im Dunkeln nach Hause zu laufen. Auf dem Weg nach Hause wird er von einigen betrunkenen Männern belästigt, die ihn zuerst für eine attraktive Frau halten und ihn aufgrund dessen sexuell belästigen. Mit der Feststellung „Das ist ja gar keine Frau!“ (1. Staffel, Folge 5, Min. 15:34) schlägt die Belästigung in Gewalt um: Eric wird bespuckt, verprügelt und anschließend allein im Wald zurückgelassen. Diese Erfahrung führt zu einem Wendepunkt im Auftreten von Eric: Er zieht sich von seiner queeren Körperperformance zurück und kleidet sich in unauffälligen, gedeckten Tönen. Er versucht, sich vorübergehend in eine wortkarge und „männliche“ Figur zu verwandeln und einer heteronormativen Norm zu entsprechen. Im Nachgang zu dieser Erfahrung verändert sich der extrovertierte, humorvolle und fröhliche Eric also vorübergehend hin zu einer angepassten, farblos gekleideten Person, die durch eine Mischung aus zurückgezogenem und teils aggressivem Verhalten in der Schule auffällig wird. Erics Erfahrungen fordern die Zuschauenden auf, sich mit der Realität eines jungen, queeren, Schwarzen Mannes in einer Gesellschaft auseinanderzusetzen, die im Rahmen einer intersektionalen Betrachtungsweise mehrere Aspekte seiner Identität als minderwertig konstruiert. Im späteren Verlauf der Serie findet Eric durch Unterstützung in seinem Umfeld wieder zu seiner inneren Kraft zurück, lebt seine Identität und damit auch sein Glück wieder frei aus.
In diesem dargestellten Beispiel wirken mindestens die Differenzlinien Sexismus, Homo- und Trans:feindlichkeit sowie Rassismus zusammen und sorgen in ihrer Wechselwirkung für eine Diskriminierungs- und Gewalterfahrung. Auch wenn es zunächst so aussieht, als hätten gewaltbereite Täter hier individuelle Entscheidungen getroffen, wäre es zu kurz gefasst, das Problem intersektionaler Diskriminierung und Gewalt auf dieser Ebene zu belassen. Menschliches Handeln ist immer in bestimmte gesellschaftlich-historisch gewachsene Kontexte eingebunden. Wir alle sind in bestimmte Macht- und Herrschaftsverhältnisse verortet, die unser Denken und Handeln prägen. Eine von Rassismus und Diskriminierung durchzogene Gesellschaft hat Einfluss auf das Denken und das Handeln jedes ihrer Mitglieder. Dass die Täter überhaupt so aggressiv auf einen nicht eindeutig weiblich bzw. männlich lesbaren Körper reagieren, hat mit abwertenden, gewaltvollen heteronormativen Diskursen zu tun, die gesamtgesellschaftlich produziert und getragen werden. Wer in diesen Diskursen welchen Platz einnimmt und einnehmen kann, wer welche Vor- und Nachteile erfährt, muss auf persönlicher, institutioneller und gesamtgesellschaftlicher Ebene genauestens reflektiert werden. Ein wichtiger Schritt dahin ist es, Ungleichheitssysteme zu erkennen. Mit Intersektionalität steht ein Analysewerkzeug bereit, Diskriminierungstatbestände zu identifizieren sowie Ungleichheit schaffende Strukturen zu erkennen und aufzubrechen (Hill Collins & Bilge, 2020, S. 2).
Fußnote
[1] „Hedwig and the Angry Inch“ ist ein Off-Broadway-Musical über eine Ostberliner Dragqueen-Legende.
Für ein Verständnis von Intersektionalität bedarf es eines Grundverständnisses von Diskriminierung und Diskriminierungsverhältnissen. Diskriminierungsverhältnisse sind das Ergebnis historisch gewachsener gesellschaftlicher Differenzordnungen, in denen Ungleichheit aufgrund willkürlich gewählter Merkmale strukturell verankert ist. Menschen werden kategorial zugeordnet und damit Benachteiligung, Ausschluss und diskriminierendes Verhalten scheinbar legitimiert.
„Diskriminierung besteht in der gesellschaftlichen Verwendung kategorialer Unterscheidungen, mit denen soziale Gruppen und Personenkategorien gekennzeichnet und die zur Begründung und Rechtfertigung gesellschaftlicher (ökonomischer, politischer, rechtlicher, kultureller) Benachteiligungen verwendet werden. Durch Diskriminierung werden auf der Grundlage jeweils wirkungsmächtiger Normalitätsmodelle und Ideologien Personengruppen unterschieden und soziale Gruppen markiert, denen der Status des gleichwertigen und gleichberechtigten Gesellschaftsmitglieds bestritten wird“ (Scherr, 2016, S. 9, Hervorh. durch Autorinnen).
Diskriminierung verstößt grundsätzlich gegen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die in ihrem Art. 1 die Gleichwertigkeit aller Menschen ohne Unterschied nach ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, Alter, Gesundheitszustand und Weiteres proklamiert (vgl. Generalversammlung der Vereinten Nationen 10.12.1948). Der Schutz vor Diskriminierung wird in Deutschland in verschiedenen Gesetzen geregelt, u. a. Sozialgesetzen, Betriebsverfassungsgesetzen etc. Die prominenteste Gesetzesgrundlage zum Schutz vor Diskriminierung bietet das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), welches seit 2006 in Folge von europäischen Richtlinien in Kraft getreten ist (Deutscher Bundestag, 2006). Das AGG identifiziert in Artikel I
• Geschlecht und geschlechtliche Identität,
• Alter,
• Behinderung,
• Religion,
• ethnische Herkunft und
• sexuelle Orientierung
als schützenswerte Merkmale. Eine Benachteiligung bzw. Diskriminierung liegt dann vor, wenn ein Verhalten oder ein Sachstand Personen oder Personengruppen aufgrund eines in Artikel 1 beschriebenen Merkmals auf sachlich ungerechtfertigte Weise benachteiligt. Der rechtliche Diskriminierungsschutz ist Ergebnis von rechtlichen und gesellschaftspolitischen Aushandlungsprozessen und bietet lediglich für diese sechs Merkmale einen rechtlichen Schutz. In Aushandlung stehen noch weitere Merkmale wie soziale Herkunft, Sprache, Aussehen, die aber bisher keinen Eingang in die allge- meine Rechtsprechung des AGG gefunden haben [1]. Neben den rechtlichen Möglichkeiten, sich gegen Diskriminierung zu schützen, gibt es allerdings eine ungleich höhere Häufigkeit an erlebter Alltagsdiskriminierung von Menschen aus marginalisierten Positionen (z. B. rassistische Beschimpfungen im öffentlichen Verkehr, die Abwertung oder Nichtbeachtung von Menschen mit Behinderung im Dienstleistungssektor), für die es bisher keine rechtliche Handhabe gibt.
Neben den schützenswerten Merkmalen definiert das AGG Formen, wie Diskriminierung ausgeübt wird. Dabei unterscheidet es zwischen direkter (unmittelbarer) und indirekter (mittelbarer) Diskriminierung [2]. Direkte Diskriminierung liegt vor, wenn eine Handlung, eine Regelung bzw. ein Gesetz Ungleichbehandlung explizit hervorruft, wie etwa das Nichteinstellen von Menschen bestimmter Herkünfte, bestimmten Lebensalters oder die Zutrittsverweigerung in Clubs mit Verweis auf eine bestimmte Hautfarbe. Ein Beispiel für eine direkte Diskriminierung in der Berufsschule wäre z. B., wenn eine Lerngruppe Schüler:innen mit nichtdeutscher Erstsprache in ihrer Gruppenarbeit ausschließt.
Ein indirekter Diskriminierungstatbestand liegt laut AGG vor, wenn eine Regelung oder Vorgabe scheinbar neutral formuliert ist und Allgemeingültigkeit beansprucht, aber in ihrer Auswirkung regelmäßig diskriminierend auf Personen bzw. Personengruppen wirkt. Verbietet eine Institution beispielsweise den Zutritt mit Kopfbedeckung, so wirkt sich diese neutral formulierte Regelung benachteiligend auf Personen aus, die aufgrund religiöser Bekenntnisse Kippa, Turban oder Kopftuch tragen, sowie auf Personen, die aufgrund von Erkrankungen (z. B. Krebspatient:innen) Kopfbedeckungen tragen. In der Berufsschule wirkt sich z. B. die gleiche – scheinbar für alle dadurch gerechte – Zeitbemessung für eine Prüfung für jene Schüler:innen, die aufgrund einer Erkrankung oder aufgrund ihres Lernstands in der Berufssprache Deutsch langsamer schreiben, benachteiligend aus.
Diskriminierungen können nicht nur nach Arten und Formen, sondern auch nach Ebenen unterschieden werden. Sie können auf individueller Ebene stattfinden, also durch beleidigende und stigmatisierende Äußerungen und (Gewalt-)Handlungen von Einzelpersonen oder Gruppen gegenüber Einzelpersonen oder Gruppen.
Diskriminierung auf institutioneller Ebene prägt den Lebensalltag aller Menschen. Jede:r von uns hat Erfahrungen in Institutionen wie Kita, Schule, Ausbildungsstätten, auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt, in Krankenhäusern und mit der Polizei gemacht. Alle Institutionen sind in ihrer Organisationskultur und Praxis mit gesellschaftlichen Vorurteils-, Wissens- und Klassenverhältnissen verwoben, welche diese prägen (vgl. El-Mafaalani, 2021, S. 74). Gemeinsame Aufgabe vieler Institutionen ist die Kategorisierung, Bewertung und Selektion (wie Schule, Gericht, Ausländerbehörden, Arbeitsagentur). Diskriminierung ist dadurch in vielen Institutionen regelhaft verankert und zieht Unterscheidungspraktiken nach sich, die für viele Menschen herabwürdigende, gewaltvolle und ausschließende Konsequenzen haben. Eine Aufgabe mit Blick auf die Berufsschule ist es, Lehrkräfte für die Lebenssituationen von Menschen in benachteiligten Positionen zu sensibilisieren und Lehrmaterialien kritisch auf ihre diskriminierenden Zugänge und Inhalte zu befragen. In Bezug auf die Gesamtorganisation „Berufsschule als Institution“ ist es bedeutsam, die vielfältigen Ausschlussmechanismen zu identifizieren und in Richtung Chancengerechtigkeit zu verändern.
Die dritte Ebene von Diskriminierung ist die strukturelle Ebene. Hier geht es um gesellschaftliche Verhältnisse, welche die Benachteiligung Einzelner oder von Personengruppen konstituieren. Wie im ersten Kapitel dieses Lehrbuches schon ausgeführt, sind die Verhältnisse des Zusammenlebens historisch durch koloniale, patriarchale, trans- und homofeindliche, klassistische und rassistische Differenzordnungen geprägt, welche die Schlechterstellung bestimmter Gruppen als „normal“ erscheinen lassen. Diskriminierende Denkweisen, Sprache, Handlungen und scheinbare Selbstverständlichkeiten durchziehen unseren kompletten Alltag. Das Ablehnen von Rassismus und Diskriminierung allein verändert nichts an der Situation. Vielmehr ist eine proaktive, bewusste Haltung gegen Diskriminierung auf allen Ebenen im privaten, politischen sowie beruflichen Handeln angesichts zunehmend menschenverachtender Handlungen und Einstellungen in dieser Gesellschaft notwendig.
Fußnoten:
[1] Das Landesantidiskriminierungsgesetz Berlin (LADG) hat aktuell bundesweit den progressivsten rechtlichen Diskriminierungsschutz und hat in seinen Merkmalskatalog auch den sozialen Status und chronische Erkrankungen aufgenommen (Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung 21.06.2020).
[2] Das AGG benennt neben der direkten und indirekten Diskriminierung auch die Belästigung, die sexuelle Belästigung und die Anweisung zur Diskriminierung und stellt diese unter Strafe.
Nachdem nun die verschiedenen Arten, Formen und Ebenen von Diskriminierung skizziert wurden, geht es im Folgenden um den Ansatz der Intersektionalität.
Intersektionalität kann als ein Analysewerkzeug verstanden werden, mithilfe dessen Herrschafts-, Macht- und Ungleichheitszusammenhänge sichtbar werden (vgl. Walgenbach, 2012, S. 2). Hierbei spielen Wechselbeziehungen und Überschneidungen verschiedener Differenzlinien eine zentrale Rolle. Anstatt nur eine Form der Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder race zu benennen, lässt eine intersektionale Perspektive Mehrfachdiskriminierung und multiple Ungleichheiten erkennbar werden. Intersektionalität nimmt die Verschränkungen von Rassismus, Sexismus, Klassismus, Transphobie, Ableismus und anderen Diskriminierungsformen auf mehreren Ebenen in den Blick. Eine große Stärke des Konzeptes ist es, dass es sich nicht auf eine bestimmte Benachteiligung fokussiert, sondern Interdependenzen – Wechselwirkungen – verschiedenster Diskriminierungskategorien analysiert und dabei Machtverhältnisse einbezieht: „Intersektionalität ist eine analytische Sensibilität, eine Möglichkeit, über Identität und ihr Verhältnis zu Macht nachzudenken.“ (Crenshaw, 2019a, S. 14). Die Offenheit dieses Konzeptes mindert die Gefahr von Essentialisierungen oder Zuschreibungen, die oft mit der Definition von Personengruppen im Kontext von Diskriminierung einhergehen. Essentialisierung beschreibt die Vorstellung, dass Menschen oder eine Kultur feste Merkmale besitzen und diese „naturgegeben“ und nicht veränderbar seien.
Ziel einer intersektionalen Perspektive ist es, die Verwobenheit von Diskriminierungserfahrungen zu erkennen/zu lesen, darauf aufmerksam zu machen und diesen entgegenzuwirken. Nur durch einen intersektionalen Blick wird es möglich, Diskriminierungserfahrungen zu erkennen, die sich erst aus dem Zusammenwirken mehrerer Differenzkategorien, wie beispielsweise Geschlecht und Herkunft, ergeben. (Mehrfach-)Diskriminierungen behindern die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, indem diese beispielsweise Zugänge zu Bildungsinstitutionen und dem Arbeits- und Wohnungsmarkt erschweren oder gar versperren. Daraus folgt, dass grundlegende Rechte, politische und kulturelle Teilhabe nicht wahrgenommen werden können. Darüber hinaus steigt das Risiko, körperliche und psychische Gewalt zu erfahren. Die andere Seite der Abwertungslogik von Diskriminierung ist die daraus resultierende Aufwertung nicht-diskriminierter Positionen. Durch die Logik von Ungleichheitsverhältnissen werden also auch Privilegien hergestellt und fixiert. Es geht in dieser Lerneinheit daher auch um die intersektionale Reflexion bestimmter Privilegien und Machtpositionen.
Die Benennung von und Auseinandersetzung mit Intersektionalität hat ihren Ursprung im Schwarzen Feminismus der 1970er- und 1980er-Jahre und in der Critical Race Theory (Crenshaw, 2019b; The Combahee River Collective, 1978 [1977]). Allerdings ist es wichtig zu wissen, dass das Thema schon weitaus früher behandelt wurde. Denn „Intersektionalität war eine gelebte Realität, bevor sie zu einem Begriff wurde.“ (Crenshaw, 2019a, S. 13). Ein bekanntes Beispiel ist die 1851 bei der Ohio Women’s Rights Convention gehaltene Rede der aus der Sklaverei geflohenen Sojourner Truth
„Ain’t I a woman?“ (2022). In dieser Rede fordert sie die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen ebenso wie zwischen Schwarzen und Weißen und greift die Problematik von Klassismus auf, was für die damalige Zeit revolutionär war:
„Der Mann sagt, dass Frauen* beim Einsteigen in eine Kutsche geholfen werden müsse, und auch beim Überqueren von Gräben und dass ihnen überall der beste Platz zustehe. Mir hat noch nie jemand in einen Wagen geholfen oder über eine Schlammpfütze oder den besten Platz überlassen! Bin ich etwa keine Frau*?“ (ebd. S. 16).
Auch wenn noch nicht unter dem Namen Intersektionalität, so wurde schon lange zuvor auf die Diskriminierung und Unterdrückung hervorbringenden Verschränkungen von Kategorien – im Fall von Truth durch die Kategorien class, race und gender – hingewiesen. Eingeführt wurde der Begriff in den 1980er-Jahren von der Schwarzen amerikanischen Juristin, Feministin und Bürger:innenrechtsaktivistin Kimberlé Crenshaw (2019b). In der DeGraffenreid-Antidiskriminierungsklage stellten im Jahr 1976 fünf Schwarze Frauen Anzeige gegen das Unternehmen General Motors. Sie warfen dem Unternehmen vor, sie aufgrund von rassistischer UND sexistischer Diskriminierung gekündigt zu haben.
„Ausgehend von den Erfahrungen der Klägerinnen konnten sich Frauen* zwar für bestimmte Jobs bewerben, für andere Jobs hingegen wurden ausschließlich Männer berücksichtigt. Das war natürlich ein Problem für sich; für Schwarze Frauen* jedoch waren die Auswirkungen deutlich eklatanter. Soll heißen: Die Schwarzen Jobs waren Männerjobs, und die Frauenjobs standen nur den Weißen offen. Während also ein Schwarzer Bewerber in der Fabrikhalle eine Stelle bekommen konnte, wurde eine Schwarze Bewerberin gar nicht erst berücksichtigt. Gleichermaßen hatte eine weiße Frau eine Chance auf Anstellung als Sekretärin, nicht jedoch eine Schwarze Frau. Weder die Schwarzen Jobs noch die Frauenjobs waren geeignet für Schwarze Frauen*, da diese weder männlich noch weiß waren.“ (Crenshaw, 2019a, S. 13 f.).
Der mit dem Fall betraute Richter wies die Klage mit folgender Begründung ab: Sowohl Schwarze Menschen (in diesem Fall nicht gegendert, da tatsächlich lediglich Schwarze Cis-Männer gemeint waren) als auch Frauen seien von dem Unternehmen eingestellt worden. Crenshaw wies jedoch darauf hin, dass es sich bei den Schwarzen Personen um Männer und bei den Frauen um weiße Personen handelte; keiner der beiden Fälle betraf eine Schwarze Frau. Schwarze Frauen wurden in dem Unternehmen zu der Zeit nicht eingestellt. Ihre Position wurde „marginalisiert und unsichtbar gemacht“ (Walgenbach, 2017, S. 159). Das Gericht konnte so entscheiden, weil es die Kategorien race und gender als isoliert voneinander betrachtete. Crenshaw konnte so nachweisen, dass die Klägerinnen nur dann vom Recht geschützt wurden, solange ihre Erfahrungen entweder weißen Frauen oder Schwarzen Männern entsprachen. Dass die in diesem Fall beschriebene Diskriminierung erst in der verschränkten Betrachtung von race und gender sichtbar wird und so zu einer eigenen Konstellation wird, wurde von der diskriminierenden Logik des Gerichts (bewusst) nicht anerkannt. Crenshaw verdeutlicht die Wechselwirkung, Gleichzeitigkeit und Überschneidungen unterschiedlicher Kategorien anhand des Bildes einer Straßenkreuzung:
„Stellen Sie sich im Vergleich den Straßenverkehr an einer Kreuzung (intersection) vor, es gibt ein Kommen und Gehen in alle vier Richtungen. Wie der Verkehr an einer Kreuzung läuft Diskriminierung vielleicht in die eine Richtung, vielleicht in eine andere. Passiert an einer Kreuzung ein Unfall, kann dieser von Autos verursacht worden sein, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen, manchmal aus allen Richtungen. Ähnlich kann die Verletzung, die eine Schwarze Frau* an der Kreuzung, der Intersection, erfährt, durch rassistische oder sexistische Diskriminierung verursacht worden sein.“ (Crenshaw, 2019b, S. 158).
Intersektionale Diskriminierung ist nicht auf Erfahrungen Schwarzer Frauen beschränkt. Wie schon erläutert, können Menschen aufgrund ihres Aussehens, ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung, ihres Alters, ihrer Sprache und wegen vieler weiterer Gründe Diskriminierung erfahren. Besonders von Diskriminierung betroffen sind jedoch jene Personen an der Schnittstelle verschiedener Diskriminierungslinien:
„Menschen of Color innerhalb der LGBTQ-Bewegungen; Mädchen of Color im Kampf gegen die School-Prison-Pipeline; Frauen* innerhalb der Einwanderungsbewegungen; Transfrauen innerhalb der feministischen Bewegungen; und Menschen mit Behinderungen im Kampf gegen Polizeimisshandlung – sie alle sind verwundbar an den Schnittstellen von Rassismus, Sexismus, Klassenunterdrückung, Transphobie oder Behindertendiskriminierung.“ (Crenshaw, 2019a, S. 15).
Katharina Walgenbach (2012) äußert in diesem Zusammenhang mit Bezug auf Lucy
N. Chebout (2016) Kritik an der Übernahme des Intersektionalitätsbegriffs in den deutschsprachigen Diskurs. Einige dieser Kritikpunkte diagnostizieren eine Vereinfachung von Crenshaws Werk, z. B. indem „intersections“ mit „Überkreuzungen“ übersetzt werden. Eine Überkreuzung verbildlicht zu wenig die Verwobenheiten, Verstärkungen und Wechselwirkungen, die vor oder nach der Kreuzung von Diskriminierungslinien stattfinden und zu den bereits beschriebenen eigenen Erfahrungen führen.
„Denn die Metapher einer Straßenkreuzung könnte suggerieren, dass die Kategorien Gender und Race vor (und auch nach) dem Zusammentreffen an der Kreuzung voneinander getrennt existierten. Mit anderen Worten: Gender und Race werden, mit Ausnahme der spezifischen Situation der Straßenkreuzung, immer noch als isolierte Kategorien gefasst.“ (Walgenbach, 2012, S. 18).
Bei intersektionalen Diskriminierungserfahrungen handelt es sich nicht nur um eine Addition von zwei oder mehreren Differenzlinien, sondern es handelt sich um heterogen strukturierte Vorgänge, die zu ganz neuen interdependenten Kategorien führen (vgl. Walgenbach, 2017, S. 65). Als eine Folge der eben angeführten Kritik führen Walgenbach et al. (2007) den Begriff der Interdependenz ein, welcher weniger die Schnittstellen als die Verwobenheit sowohl zwischen als auch innerhalb bestimmter Kategorien in den Fokus nimmt. Damit werden unterschiedliche Positionierungen und Zugänge zu Ressourcen nicht festgelegt und essentialisiert. Mit diesem Blick laufen soziale Ungleichheiten zudem weniger Gefahr, vereinfachend mit Bildern wie: Oben – Unten, Unterdrückende – Unterdrückte etc. dargestellt zu werden. Stattdessen rückt die räumlich-zeitliche Kontextabhängigkeit und Mehrdimensionalität von Macht- und Herrschaftsgefügen in das Zentrum der Analyse.
Allgemeinbildende Schulen und Berufsschulen sind Orte, die in bestehende Herrschafts- und Dominanzstrukturen eingebunden sind. Berufsschüler:innen sind in ihrem bisherigen Bildungsverlauf durch ein selektives und Ungleichheit (re)produzierendes Schulsystem (Grundschule, weiterführende Schulen, Förderschulen etc.) gegangen. Bourdieu und Passeron (1971) stellten schon vor mehr als 50 Jahren fest, dass lediglich eine „Illusion der Chancengleichheit“ im Bildungssystem besteht. Dies konnte und kann in zahlreichen Studien belegt werden (Deutsches PISA-Konsortium 2001 und folgende Jahre). Immer wieder zeigt sich: In Deutschland hängt der Abschluss von Schüler:innen eng mit dem sozioökonomischen Status der Eltern zusammen. Darüber hinaus wirken Kategorien wie Klasse, Geschlecht und Ethnie in Bildungsinstitutionen hinein, strukturieren Bildungserfolge mit und führen zu Diskriminierungen. Wie bereits ausgeführt, finden Diskriminierungen auf persönlichen, strukturellen und institutionellen Ebenen statt. Alle Ebenen haben Einfluss auf die Organisation Berufsschule. Damit sind (Berufs-)Schulen Orte, an denen Diskriminierung erzeugt und wiederholt wird (Gomolla & Radtke 2009, S. 17). Intersektionalität kann als ein Analysewerkzeug in der (Berufs-)Schule und Lehrer:innenprofessionalisierung angesetzt werden, um Ungleichheitsbehandlung und Bildungsbenachteiligung in ihrem Zusammenwirken zu erkennen und entgegenzutreten. Hierzu braucht es umfassende Maßnahmen für die Herausbildung einer intersektionalen pädagogischen Haltung seitens der Lehrpersonen, aber auch in Bezug auf die Organisation der Berufsschule an sich. Ohne eine Sensibilisierung ist es nicht möglich, die unsichtbaren, als „normal“ empfundenen Unterscheidungspraxen und -strukturen in gegebenen Machtverhältnissen zu erkennen. Zum einen müssen wir uns ein theoretisches Wissen über Diversität, Diskriminierung, Rassismus und intersektionale Interdependenzen aneignen. Nur so können wir Formen der diskriminierenden Strukturen besser erkennen. Zum anderen müssen wir uns mit unseren eigenen Vorurteilen, Privilegien und diskriminierenden Praxen befassen. Darüber hinaus ist es notwendig, die Strukturen innerhalb der Institutionen auf intersektionale Diskriminierungen hin zu analysieren und infolgedessen Veränderungsprozesse anzustoßen. Dabei muss die Berufsschule als Lernort an die Bedürfnisse einer heterogenen Schüler:innenschaft angepasst werden, nicht andersherum. Also nicht die Schüler:innen müssen „eingepasst“ werden, um innerhalb einer starren Institution zu „funktionieren“. Intersektionalität trägt dazu bei, eine Querschnittsperspektive einzunehmen, welche alle Beteiligten in und um die Berufsschule in den Blick nimmt und damit ein hilfreiches Instrument sein kann, um Veränderungsprozesse zu initiieren.
Nehmen Sie bitte 2-3 ihnen bisher nicht bekannte Begriffe aus dem Text und erläutern Sie diese in ein paar Sätzen.
Sammeln Sie Eckpunkte für den Mini-Entwurf einer Antidiskriminierungsrichtlinie für eine Berufsschule. Benennen und beschreiben Sie bitte kurz mindestens 5 Aspekte, die Ihnen wichtig erscheinen. Orientieren Sie sich dabei an bestehenden Gesetzen (z. B. AGG) und beziehen Sie diese mit in Ihren Entwurf mit ein.
Ergänzen Sie in Ihrer Richtlinie eine Präambel (eine Art Vorwort), in dem Sie auf die Relevanz eingehen, Diskriminierungen intersektional zu betrachten.
Sie lesen lieber ein Buch?
Über die folgenden Schaltfläche kommen sie zu unserem OER-Buch: