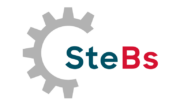Modul 2 |
Sprache und Macht
Sprache und Macht
In dieser Lerneinheit wird in die Zusammenhänge von Sprache und Macht eingeführt. Hierfür wird in einem ersten Schritt die performative Kraft von Sprache erläutert. Mithilfe von subjektivierungstheoretischen Ansätzen folgt daran anschließend ein Nachdenken über die Frage, wie Subjektpositionen über Sprache hergestellt werden.
In diesem Modul geht es darum, Impulse zu setzen, die dabei helfen, über das eigene Sprechen machtkritisch nachzudenken. Durch eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Formen und Funktionen von Sprachhandeln soll eine differenziertere Analyse des Zusammenhangs von Sprache und Macht ermöglicht werden. Wir beziehen uns dabei vor allem auf das eigene pädagogische Sprechen, wie es in Lern- und Bildungsräumen der (Berufs-)Schule wirksam wird.
- Theorie
- Aufgaben & Reflexion
Sprache ist überall: zu Hause und in der Schule, in der Öffentlichkeit, im Privaten und in den Zwischenbereichen; Hatespeech, Cybermobbing, sprachliche Propaganda in politischen Kämpfen, Koseworte, Lob, demotivierende und stärkende, verletzende und heilende Worte etc. Gesprochene Sprache zeigt sich in unterschiedlichen Formen, und es gibt unzählige Perspektiven auf Sprache und ihre verschiedenen Ebenen. In dieser Lerneinheit geht es um jene Formen des Sprachhandelns, die im Rahmen unserer pädagogischen Arbeit als Berufsschullehrperson relevant werden. Dabei bezieht sich diese Lerneinheit auf Textbeiträge aus der Ungleichheitsforschung und der differenztheoretischen Forschung. Insbesondere werden hier Ansätze aus der Sprachphilosophie von u. a. John L. Austin (1998) und Judith Butler (2019) aufgegriffen und für pädagogische Fragestellungen aufbereitet.
Eine zentrale Frage ist, inwiefern Sprache dazu beiträgt, Wirklichkeit zu konstruieren. Mit Blick auf den Schulalltag liegt zudem die Frage nahe, welche Formen, Arten und Weisen von Sprache welche Art von „Wirklichkeit“ produzieren. Insbesondere ist es interessant, darüber nachzudenken, wie Sprache für die Bildungs- und Subjektivierungsprozesse einzelner Schüler:innen im Lernraum – aber auch darüber hinaus im weiteren Verlauf ihrer (Bildungs-)Biografie – relevant werden. Da es uns vor allem darum geht, verletzendes, diskriminierendes, kategorisierendes, festschreibendes und ausschließendes Sprechen im Lernraum zu reduzieren und gleichzeitig heilendes, respektvolles, anerkennendes Sprechen zu stärken, beschäftigen wir uns im Folgenden damit, wie ein machtkritisches und differenzsensibles Sprechen möglich wird, das sich kritisch-reflexiv auf verschiedene Differenzkategorien wie etwa Geschlecht, Kultur, Sprache, Klasse, Dis/ability im Berufsschulalltag bezieht.
Dazu lassen sich zunächst verschiedene Ebenen von Sprache bestimmen, um sie für eine Analyse zugänglich zu machen. Die Sprache des (Berufs-)Schulalltags ist eine andere als jene, welche beispielsweise im Bundestag verwendet wird, oder jene, die am Kiosk gesprochen wird. Die verschiedenen Formen des Sprechens können als verschiedene Sprachregister (Alltagssprache, Bildungssprache, Unterrichtssprache, Geheimsprache, Amtssprache, Umgangssprache, Wissenschaftssprache, Jugendsprache usw.) bezeichnet und unterteilt werden. Ein weiterer Aspekt, der für eine Analyse relevant ist, ist die Tonalität des Sprechens. Also wie laut und leise, sachlich, ironisch, autoritär, kollegial usw. gesprochen wird und wie dieses Sprechen mit entsprechender Mimik und Gestik begleitet wird. Diese angesprochenen Ebenen vollziehen sich während des Sprechens oder genauer im Akt- und Handlungscharakter der Sprache bzw. des Sprechakts/der Sprachhandlung (weiterführend s. Austin und Savigny, 1998). Neben der beschreibenden Ebene (Register/Tonalität etc.) gibt es auch eine inhaltlich-diskursive Ebene der Sprache. Diese Ebene ist es, die eine performative Wirkung oder anders ausgedrückt: einen Einfluss auf die Konstruktion von Wirklichkeit hat. So können kurze Sätze, beiläufige Bemerkungen, vermeintlich selbstverständliche Ansprachen, Fragen, Annahmen und Schlussfolgerungen Schüler:innen im Klassenraum beispielsweise als
„Andere“ herstellen (vgl. Rose, 2010). Wenn davon gesprochen wird, dass jemand als
„anders“ hergestellt wird, ist damit gemeint, dass diese Person als jemand adressiert [1] wird, der:die „anders“ als der ‚Normalfall‘ sei, also von der herrschenden Norm abweiche. Anders als die Deutschen, anders als die Schüler:innen, die nicht behindert wer- den, anders als die Schüler:innen, die keine Geldsorgen zu Hause haben etc. Diese Normen wiederum – also die Frage, was in der Gesellschaft als normal und was als Abweichung gilt – werden durch Diskurse hergestellt, die in der Lerneinheit „Pädagogische Professionalisierung in Differenzverhältnissen“ (Modul 1) schon kurz erläutert wurden. Da es immer viele verschiedene Diskurse gleichzeitig gibt, die in einer Gesellschaft produziert werden, lassen sich die Diskurse, die besonders wirkmächtig sind, dadurch unterscheiden, dass wir sie als „hegemoniale Diskurse“ bezeichnen. Hegemoniale Diskurse bestimmen Normalitäten und damit Denk- und Handlungsweisen in einer Gesellschaft, die wiederum die erlebte Wirklichkeit mitbestimmen. So entstehen aus hegemonialen Diskursen entlang der Differenzordnungen Ansprachen wie: „Geh doch lieber auf die Realschule, deine nicht in Deutschland geborenen Eltern können dir auf dem Gymnasium ja gar nicht helfen.“, oder „Du willst Ärztin werden? Dann nimm lieber das Kopftuch ab.“ In beiden Aussagen (re)produzieren Lehrkräfte im Sprechen Differenzlinien, hier: race, Kultur, sozioökonomische Herkunft. Anstatt diesen in der Schule sprachlich entgegenzuwirken, werden sie durch so eine Art des Sprechens weiter stabilisiert und reproduziert. Die Ansprache der Lehrperson und die damit verbundene Platzzuweisung, wie sie in dieser pädagogischen Alltagssituation auf- taucht, weist stets auch auf (Vor-)Annahmen der Lehrperson hin. Aus dem bisher Erläuterten wird deutlich: Sprachliche Äußerungen beschreiben nicht nur die Welt oder behaupten etwas, sondern vollziehen sich in (Sprach-)Handlungen. Durch ihre Aus- und Aufführung, ihren Vollzug, wird Wirklichkeit erzeugt. Jeder Sprechakt kann
– wie jede andere Handlung auch – gewaltsam und verletzend sein (Posselt, 2019, S. 17).
Fußnote
[1] „Adressieren“ ist in diesem Fall ein Fachbegriff, der sich auch grob mit „ansprechen“ übersetzen lässt. Oft findet sich auch der Ausdruck „anrufen“: Eine Person sei als XXX angerufen worden. Dazu finden Sie Erläuterungen unter dem nächsten Punkt „Annäherung an die Subjektivitätstheorie“.
Um von hier aus den Zusammenhang zwischen den einzelnen Sprechakten im Klassenraum und der gesellschaftlichen Makroebene vertiefter zu verstehen, wenden wir uns im Folgenden der Subjektivierungstheorie näher zu. Ganz grundlegend lässt sich Subjektivierung als jener Vorgang beschreiben, durch den Individuen zu Subjekten
„werden“ und „gemacht werden“. Im Anschluss an Louis Althusser (2010) wird hier das Konzept der „Anrufung“ (oder auch Interpellation) relevant, welches Menschen als Menschen in bestimmten gesellschaftlichen Positionen (vgl. auch das Gender-Modul zum Zusammenhang zwischen Anrufung und Geschlecht) adressiert. Die viel zitierte Figur der „Anrufung“ (Interpellation) von Louis Althusser bezieht sich auf die von ihm beschriebene Szene, in der ein Polizist einem Menschen auf der Straße zuruft: „He, Sie da!“ (Althusser, 2010, S. 88) und dieser sich prompt umdreht. Durch die Wendung um 180 Grad – durch die Unterwerfung unter die Anrufung – wird der Mensch zum Subjekt, da das angerufene Individuum „anerkennt, dass der Anruf „genau“ ihm galt und dass es gerade er war, das angerufen wurde (und niemand anderes)“ (vgl. ebd.,
S. 89). Durch die Anrufung wird das Individuum also zugleich unterworfen und formt sich zum Subjekt oder mit Althusser gesprochen beschreibt diese Szene einen „Vorgang, (…) [in dem] Individuen zu Subjekten „transformiert“ [werden]“ (vgl. ebd., S. 88). In diesem Fall einen Bürger, der sich der staatlichen Ordnung unterwirft. Diese Szene lässt sich auch noch anders interpretieren und wurde schon vielfach weiterentwickelt (Butler, 2019, S. 82). Sie dient aber als gutes bildliches Beispiel für die Grundidee, dass sich Subjekte zu sprachlichen Anrufungen verhalten und sich in diesem Verhalten
„unterordnen“ oder eben auch „widersetzen“. Im Anschluss und in einer Weiterentwicklung von Althussers Überlegungen beschreiben auch Judith Butler und Michel Foucault Subjektivierung als den Vorgang, durch den Individuen in die herrschenden (diskursiven) Ordnungsverhältnisse eingepasst und auf einen bestimmten Platz verwiesen werden. Dabei entwickeln Foucault und Butler in der Auseinandersetzung mit den herrschenden (diskursiven) Ordnungsverhältnissen jedoch ein erweitertes Macht- und Subjektverständnis: Im Anschluss an Foucault (und Butler) unterwirft sich das Subjekt einerseits gesellschaftlichen Normen, gestaltet diese aber andererseits durch sein unterwerfendes Verhalten gleichzeitig auch mit. Subjektivierung ist demnach „[…] eine Art von Macht, die nicht nur einseitig beherrschend auf ein gegebenes Individuum einwirkt, sondern das Subjekt auch aktiviert und formt“ (Butler, 2019, S. 82). Subjektivierungsprozesse regulieren insofern Menschen und erzeugen sie zugleich als Individuen. In der Anrufung als Jemand gibt es immer auch die Möglichkeit, die vorgefertigte Position nicht einzunehmen, sich dagegen zu entscheiden, sich nicht um 180 Grad in der Anrufung umzudrehen. Lehrpersonen und Schüler:innen können sich gegen die diskursiven Ordnungsverhältnisse stellen und alternative Sprechhandlungen, also Anrufungen, vollziehen. Diese wiederum wirken auf die diskursive Wirklichkeit ein, können diese verändern, sind aber auf Wiederholungen angewiesen. Denn erst in der Wiederholung entstehen wirklichkeitsgestaltende Strukturen, aus denen wiederum neue Positionen entstehen und verhandelt werden können.
Wenn Individuen – Lehrpersonen wie auch Schüler:innen – also durch die Anrufung in herrschende gesellschaftliche Ordnungen „unterworfen“ werden und dadurch bestimmte Positionen als Subjekte erhalten und einnehmen, von denen aus sie sprechen und handeln können, dann lassen sich die beiden eben schon zitierten Beispiele von pädagogischen Ansprachen nochmals vertiefter verstehen: „Geh doch lieber auf die Realschule, deine nicht in Deutschland geborenen Eltern können dir auf dem Gymnasium ja gar nicht helfen.“, oder „Du willst Ärztin werden? Dann nimm lieber das Kopftuch ab.“ In der Folge dieses Sprechens erhalten Kinder dann beispielsweise nicht die Gymnasialempfehlung, obwohl ihre Leistungen dies zulassen würden, oder Jugendliche werden möglicherweise demotiviert, ihren Weg als Ärztin/Lehrerin etc. einzuschlagen, weil ihre Form der Religionsausübung zu dem angestrebten Beruf diskursiv in einen Gegensatz gebracht wird. Die Platzzuweisung, die durch die in diesem Fall gut gemeinte pädagogische Ansprache der Lehrperson vollzogen wird, ist eingewoben in machtvolle Ordnungsverhältnisse, in denen Normen und Normalitätsvorstellungen gegenüber marginalisierten Jugendlichen das pädagogische Denken und Handeln der Lehrperson beeinflussen.
Zusammenfassend lässt sich zu dem Verhältnis zwischen Sprache – Macht – Wirklichkeit daher sagen, dass Sprache nicht nur wirklichkeitsbeschreibend, sondern auch wirklichkeitserzeugend ist. Sie existiert nicht neutral im Raum, sondern produziert Verhältnisse. Die machtvollen diskursiven Ordnungsverhältnisse, aus denen Individuen als Subjekte hervorgehen, werden im (pädagogischen) Sprechhandeln wiederholt, bestätigt und verfestigt und entfalten eben in ihrer Wiederholung ihre Wirkmächtigkeit.
Jegliches Sprechen als Subjekt setzt nach Foucault (2016) voraus, dass wir eine bestimmte Sprecher:innenposition in den (diskursiven) Ordnungsverhältnissen eingenommen haben, von der aus wir sprechen und handeln (vgl. 2016, S. 78). Das kann
z. B. die Position einer weißen, heterosexuellen, christlichen Frau sein, die in Armut aufgewachsen ist und über einen Bildungsaufstieg einen guten sozioökonomischen Status erlangen konnte. Oder die eines nicht weißen, queeren Mannes mit einer chronischen Erkrankung. Mit den unterschiedlichen Subjekt- und Sprechpositionen sind unterschiedliche Erfahrungen und Handlungsmöglichkeiten verbunden. Vor dem Hintergrund der theoretischen Ausführungen zum Zusammenhang zwischen Subjekt, Macht und Wirklichkeit lassen sich Situationen der sprachlichen Interaktion aus dem pädagogischen Alltag nun genauer als Teil gesamtgesellschaftlicher Machtverhältnisse verstehen.
Beschreiben Sie anhand eines konkreten Beispiels, das Sie sich überlegen, den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Diskursen, Normen, pädagogischem Sprechhandeln und Subjektivierungsprozessen von Schüler:innen. Beziehen Sie bitte alle diese Begriffe sowie konkrete Verweise auf den gelesenen Text in Ihre Antwort ein.
Suchen Sie ein Musikstück heraus, in dem es um die (produzierende/gewalt- volle/heilende) Macht von Sprache geht, teilen Sie es und schreiben Sie noch circa fünf Sätze hinzu, die deutlich machen, welchen Zusammenhang Sie zwi- schen dem Text des gewählten Liedes und den hier gelesenen Ausführungen sehen.
Sie lesen lieber ein Buch?
Über die folgenden Schaltfläche kommen sie zu unserem OER-Buch: