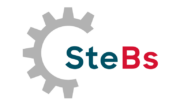Modul 8 | Antisemitismus
Antisemitismus
Diese Lerneinheit lädt zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Antisemitismus ein und hat das Ziel, ein grundlegendes Verständnis für Antisemitismus zu schaffen, seine Definitionen und Ausdrucksweisen zu beleuchten und konkrete Strategien zu erarbeiten, um ihm entgegenzutreten. Der Text beginnt mit der Frage: Was ist Antisemitismus und wie kann er definiert werden? Anschließend widmet sich diese Einheit der Frage, wie Antisemitismus in der Schule begegnet werden kann. Hier geht es darum, wie Antisemitismus in der Schule wirkt und was sich daraus für pädagogische Konsequenzen ergeben.
- Einstieg
- Theorie
- Aufgaben & Reflexion
Antisemitismus in Schule ist keine Neuheit. Antisemitische Äußerungen und Handlungen richten sich nicht nur gegen jüdische Schüler:innen, Eltern oder Lehrkräfte, sondern können auch nicht-jüdische Personen betreffen oder über Sprache und In- halte wirksam werden – etwa durch Zuschreiben von Positionen, antisemitisch konnotierte Bemerkungen, die Verwendung unterschwellig antisemitischer Bildsprache oder den unkritischen Einsatz von Lehrmaterialien und Schulbüchern.
Lehrkräfte an (Berufs-)schulen sind in besonderer Weise mit Antisemitismus konfrontiert: Nicht nur im Raum Schule, sondern – insofern sie eine deutsche Familienbiografie haben – ebenfalls durch ihre persönliche Familiengeschichte: Die Ergebnisse einer Studie von Lorenz-Sinai (2024) verdeutlichen, dass Lehrkräfte nach emotionaler Verbindung zur Geschichte und nach Handlungsmöglichkeiten suchen, während sie sich im Spannungsfeld zwischen öffentlicher Erinnerungskultur und familiärer (Nicht-)Auseinandersetzung mit der Shoah bewegen und im Klassenraum den unterschiedlichen Bezügen der Schüler*innen zum Thema gerecht werden sollten. Diese mehrfache Konfrontation erfordert sowohl pädagogisches Feingefühl, fundiertes Wissen sowie eine Reflexion der eigenen pädagogischen Haltung (Chernivsky et al., 2020; 2024; Karakayali & Holler, 2022).
Mit Blick auf die Gesamtgesellschaft zeigt sich, dass bestimmte Geschichtsbilder und Erzählmuster immer wieder auftauchen (Papendick et al., 2020). Diese zeichnen sich durch ein weitgehendes Schweigen über die eigene familiäre Verstrickung in die nationalsozialistische Diktatur, durch Narrative der Selbstviktimisierung, eine Betonung des eigenen Leids im Zweiten Weltkrieg, durch große emotionale und soziale Distanz zu jüdischen Menschen und anderen Opfergruppen sowie durch die Vorstellung aus, dass die eigenen Vorfahren entweder unbeteiligt oder sogar Teil des Widerstands gewesen seien (Lorenz-Sinai, 2024, S. 242).
Aus den beschriebenen dominanzgesellschaftlichen Geschichtsbildern können für den Berufsschulkontext mehrere zentrale Konsequenzen abgeleitet werden: Erstens wird deutlich, wie wichtig die biografische Selbstreflexion von Lehrkräften ist: Die Auseinandersetzung mit eigenen familiären Narrativen zur NS-Zeit kann helfen, unbewusste Übernahmen von Entlastungs- oder Verdrängungsgeschichten zu erkennen und kritisch zu hinterfragen. Zweitens bedarf es eines multiperspektivischen und antisemitismuskritischen Geschichtsunterrichts, der jüdische Stimmen sichtbar macht, ohne jüdische Schüler:innen vor der Klasse bloßzustellen, indem sie über ihr Leben oder „das Judentum“ etwas sagen müssen.
So kann beispielsweise die Förderung von historischer Empathie im Zentrum stehen – jedoch jenseits einer rein affektgesteuerten Betroffenheitspädagogik. Vielmehr gilt es, pädagogische Ansätze zu entwickeln, die Nähe zu den Opferperspektiven ermöglichen und zugleich zur kritischen Auseinandersetzung befähigen.
Drittens stellt sich die Frage, wie Schulen Räume schaffen können, in denen auch die vielfältigen biografischen und kulturellen Bezüge der jüdischen Schüler:innen Raum bekommen und reflektiert werden, ohne sie zu überfordern oder zu stigmatisieren. Viertens muss auf Beschwerden seitens jüdischer Schüler:innen und ihrer Eltern konsequent und ernsthaft reagiert werden und die Betroffenen müssen aktiv in den Lösungsprozess eingebunden werden.
Aus diesen Überlegungen kann abgeleitet werden, dass Berufsschulen Antisemitismuskritik nicht nur inhaltlich vermitteln müssen, sondern auch strukturell und biografisch reflektieren – bei Lehrkräften wie bei Schüler:innen. Ziel dieser Lerneinheit ist es, hierfür einleitende Impulse zu setzen und Angebote zu machen.
Antisemitismus beginnt nicht erst bei offener Gewalt, sondern schon bei stereotypen Zuschreibungen und der Kategorisierung von Menschen. Wenn im Schulalltag von
„den Juden“ gesprochen wird oder unbewusst angenommen wird, dass keine jüdischen Personen anwesend sind, schafft das bereits Ausgrenzung. Ein typisches Muster ist die sprachliche Gegenüberstellung von „Deutschen und Juden“ – als könnten Menschen nicht beides gleichzeitig sein. Diese Trennung zeigt sich im Berufsschulkontext besonders deutlich, wenn etwa im Unterricht über jüdisches Leben nur in historischen oder ausländischen Kontexten gesprochen wird, nicht aber als selbstverständlicher Teil der deutschen Gegenwart.
Antisemitismus ist ein komplexes Phänomen, welches subtile Vorurteile, historisch gewachsene Stereotype und spezifische Verschwörungsnarrative umfasst, die sich über Jahrtausende entwickelt haben. Es manifestiert sich in verschiedenen Formen – vom religiösen Judenhass/Antijudaismus über rassistischen Antisemitismus bis hin zu Ausprägungen nach der Shoah. Charakteristisch ist die widersprüchliche Zuschreibung sowohl übermäßiger Macht als auch Minderwertigkeit. Antisemitismus dient als Projektionsfläche für gesellschaftliche Krisen und wandelt sich kontinuierlich, während seine grundlegenden Strukturen bestehen bleiben.
Ein wichtiges Merkmal des Antisemitismus ist die Umkehr von Täter:innen und Opfern:
„Im Unterschied zum kolonialen Anderen ist der antisemitisch markierte Andere nicht nur minderwertig, sondern mit Macht ausgestattet. Und deshalb gefährlich. Antisemitismus bietet Gelegenheit, sich selbst als Opfer zu sehen und sich vorzustellen, beherrscht und ausgebeutet zu werden.“ (Messerschmidt, 2005, S. 139)
Antisemitismus kann als eine „flexible Ideologie“ (Messerschmidt, 2022b) verstanden werden, durch welche sich Feindbilder und gewaltvolle Vorurteile festigen, unabhängig von den tatsächlichen Handlungen von Jüd*innen. Antisemitische Gewalt bedroht den Alltag und das Leben von Jüd*innen. Ähnlich wie Rassismus bedient sich auch Antisemitismus des „Othering-Prinzips“ (Hall, 2003 [1997]): Jüd*innen werden durch Stereotype und antisemitische Vorurteile entindividualisiert und als das schlechte „Andere“ in Gegenüberstellung zu vermeintlich gleichen und guten Individuen konstruiert. Diese Vorurteile „sind ideologische Konstruktionen eines Feindbildes, die als Phantasmen die Wahrnehmung der Wirklichkeit verzerren.“ (Bernstein, 2020, S. 38). Es mag paradox klingen, aber antisemitische Feindbilder festigen sich, gerade weil sie falsch und flexibel sind.
Wird erklärt, was Antisemitismus ist, spielen Situationsbeschreibungen und Beispiele, wie oben ausgeführt, eine große Rolle. Sie stellen den Versuch dar, der Vielschichtigkeit antisemitischer Erscheinungsformen gerecht zu werden, indem Antisemitismus anhand konkreter Beispiele nach der Darstellung einer Begriffsdefinition erklärt wird. Es gibt keine alleinige, allgemein anerkannte Definition. Antisemitismusforscher:innen stellen sich die Frage, ob es aufgrund der Komplexität und stetigen Veränderung überhaupt eines einheitlichen Begriffs bedarf (Ullrich et al., 2024; Ullrich 2022). Denn je nach wissenschaftlicher Tradition und Forschungsperspektive existieren verschiedene theoretische Ansätze und Begriffsbestimmungen zu Antisemitismus. Auch ist Antisemitismus an historische und gesellschaftliche Kontexte gebunden und wandelt seine Erscheinungsformen entsprechend der jeweiligen Epoche. Diese Anpassungsfähigkeit zeigt sich darin, dass antisemitische Vorurteile und Feindbilder zwar auf ähnlichen Grundmustern basieren, aber ihre konkreten Ausdrucksformen den zeitgenössischen Verhältnissen anpassen. Antisemitismus kann folglich als eine „flexible Ideologie“ (Messerschmidt, 2022b, S. 79; Mendel et al., 2022) verstanden wer- den. Viele Forscher:innen im Bereich Antisemitismus haben sich nicht zum Ziel gesetzt, „den einen wahren Begriff zu destillieren“ (Ullrich et al., 2024, S. 10), um Antisemitismus zu beschreiben, sondern die Vielfältigkeit aufgezeigt.
Im Folgenden werden kurz die zwei geläufigsten Definitionen vorgestellt, die in der Auseinandersetzung mit Antisemitismus immer wieder herangezogen werden. Sie beschreiben Antisemitismus sehr weit gefasst und veranschaulichen unterschiedliche Erscheinungsformen dann anhand von Beispielen und Situationsbeschreibungen.
Es sollte bedacht werden, dass Definitionen lediglich Hilfsmittel, nicht letzte Wahrheiten sind. Als nützliche Werkzeuge und Abkürzungen können sie Probleme lösen helfen. Sie bieten jedoch keine erschöpfende Darstellung der Wirklichkeit.
Die „Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance“, kurz IHRA, [1] wird in Europa und international von vielen Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen verwendet. Der Titel ‚Arbeitsdefinition‘ sagt bereits aus, dass es sich hier um keine abgeschlossene Begriffsbestimmung handelt. Sie ist anwendungsbezogen und hilft, Antisemitismus in der Praxis zu erkennen, zu benennen und dagegen vorzugehen, und ist weniger für wissenschaftliche oder juristische Bereiche ausgelegt. Antisemitismus ist laut dieser Definition
„[…] eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. (International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), 2016)“
Die IHRA-Definition wird durch elf Beispiele erweitert. [2] Neben weiteren merken Holz (2024) und Hirschauer (2025) an, dass die zentrale Formulierung zu allgemein gefasst sei: Antisemitismus wird als eine „bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden“ beschrieben – ein Begriff, der irreführend sei. Er suggeriere, antisemitische Vorstellungen seien fehlerhafte Wahrnehmungen realer Eigenschaften, etwa wirtschaftlicher Aktivitäten. Wissenschaftlich gilt jedoch: Antisemitismus beruht nicht auf tatsächlichen Eigenschaften jüdischer Menschen, sondern auf Projektionen, Fantasien und ideologischen Konstruktionen. Es handelt sich nicht um Wahrnehmung, sondern um ein „Gerücht über die Juden“ (Adorno, 1951/2001, S. 9). Das bedeutet: Antisemitismus hat nichts mit den realen jüdischen Menschen zu tun. Daraus folgt: Ganz gleich, wie sich Jüd*innen verhalten, Antisemitismus entsteht und besteht unabhängig davon. Dies ist grundlegend wichtig zu verstehen, da sich die Vorurteile und Annahmen aus der Projektion und Fiktion der nichtjüdischen Personen speisen. Antisemitismus spricht Menschen auf einer emotionalen Ebene an und „ist zu verstehen als eine Verbindung aus Weltanschauung und Leidenschaft, also eine spezifische Art zu denken und zu fühlen“ (Kurth & Salzborn, 2019, S. 6). Darüber hinaus zeigt sich Antisemitismus nicht nur in „Hass“, sondern kann darüber hinaus auch in Form von Ekel, Scham oder Neid (Holz, 2024) äußern.
Die zweite populäre Definition ist die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus (JDA) aus dem Jahr 2021. Sie ist laut ihrer Verfasser:innen als Antwort auf die IHRA-Definition entwickelt worden (JDA, 2021). Sie erhebt den selbsternannten Anspruch, explizit zwischen legitimer Kritik an der Politik des Staates Israel und antisemitischen Äußerungen zu unterscheiden.
In ihrem theoretischen Kernaufbau weist die JDA keine fundamentalen Unterschiede zu der IHRA-Definition auf (Haury, 2023, S. 299–300). Sie charakterisiert Antisemitismus ebenfalls auf einer primär beschreibenden Ebene, benennt diese allerdings konkreter als „Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit oder Gewalt gegen Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden“. Auch sie arbeitet zur Verdeutlichung mit einem Katalog illustrativer Beispiele.
Die Antisemitismus-Definition der JDA lautet:
„Antisemitismus ist Diskriminierung, Vorurteil, Feindseligkeit oder Gewalt gegen Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden (oder jüdische Einrichtungen als jüdische).“ (JDA, 2021).
Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) (Kinzel & Poensgen, 2024) und andere weisen u. a. darauf hin, dass die JDA-Definition eine bedeutende Einschränkung aufweist: Sie benennt ausschließlich Jüd:innen als Betroffene von Antisemitismus und spezifiziert dies noch enger als „Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden“. Diese Formulierung ignoriert die Erkenntnisse der Antisemitismusforschung sowie die Praxiserfahrungen von RIAS und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die belegen, dass antisemitische Angriffe auch gegen nichtjüdische Personen gerichtet sein können.
Im Kontext der teils gegensätzlichen Antisemitismusdefinitionen wie IHRA und JDA plädiert dieser Text, sich nicht an polarisierenden Entweder-oder-Logiken zu orientieren. Hilfreich ist, anzuerkennen, dass es Bereiche gibt, die diskursiver Auseinandersetzung bedürfen: Demokratie, Bildung und Aufklärung erfordern kontinuierliche reflexive Anstrengungen und weniger, sich in Kämpfe um Positionierung zu begeben – sprich, sich für oder gegen eine Definition zu stellen. Die gegenwärtige Antisemitismuskritik läuft sonst Gefahr, ihre kritische Qualität und Tiefenschärfe einzubüßen (Holz & Bisky, 2024).
Fußnoten
[1] Die IHRA ist ein Zusammenschluss von etwa 35 Staaten, dem neben nahezu allen europäischen Ländern auch Argentinien, Australien, Kanada, die USA und Israel angehören.
[2] Die IHRA-Definition entstand als Reaktion auf den nach 2000 verstärkt wahrgenommenen „Antisemitismus gegen Israel“. Sieben der elf Beispiele beziehen sich explizit auf israelbezogenen Antisemitismus. Ein zentraler, oft übersehener Aspekt der Definition ist jedoch der Hinweis auf die Kontextabhängigkeit: „Ob es sich bei solchen Aussagen tatsächlich um Antisemitismus handelt, kann nur ‚unter Berücksichtigung des Gesamtkontexts‘ entschieden werden“ (Holz, 2024). Die angeführten Beispiele sind daher als Analysehilfen zu verstehen, die eine differenzierte Betrachtung unterstützen, aber nicht ersetzen können.
Dass Antisemitismus in Schulen zugenommen hat, ist vor dem Hintergrund eines deutschland- und weltweiten Anstiegs von Antisemitismus nicht verwunderlich.
Seit 2023 hat sich die Anzahl antisemitischer Gewalttaten drastisch erhöht – deutsche Behörden registrierten über 5.000 antisemitische Straftaten – und bleibt seither unverändert auf diesem hohen Niveau (BMI, 2024). Diverse Studien wie die Mitte-Studie (Zick & Küpper, 2023) und die Autoritarismusstudie der Universität Leipzig (Decker et al., 2022) belegen dies. Die Mitte-Studie 2023 etwa verzeichnet einen Anstieg antisemitischer Einstellungen in Deutschland.
Durch eine Studie der Universität Bielefeld von Zick, Hövermann, Jensen, Bernstein und Perl (Zick et al., 2017) aus dem Jahr 2017 konnte herausgearbeitet werden, dass nur etwa ein Viertel der Betroffenen antisemitischer Vorfälle diese auch melden und daher von einer immens höheren Dunkelziffer ausgegangen werden muss. Als Grund für das Nichtanzeigen von Straftaten wird auch der Mangel an Vertrauen in die öffentlichen Behörden angegeben.
Für den Bereich Schule zeigt sich folgendes Bild: Studien wie die Bundesländerstudienreihe des Kompetenzzentrums für antisemitismuskritische Bildung und Forschung [1] und Bernsteins Studie zu Antisemitismus an Schulen in Deutschland (Chernivsky & Lorenz-Sinai, 2024; Bernstein, 2020) untersuchen, wie pädagogisches Personal Antisemitismus wahrnimmt und damit umgeht, und wie jüdische junge Erwachsene ihn im schulischen Alltag rückblickend erleben und verarbeiten – mit dem Ziel, Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den Perspektiven von Betroffenen und Nichtbetroffenen herauszuarbeiten. Bewusst nimmt die Studie auch die persönliche Involviertheit der befragten Lehrkräfte mit auf, indem sie nach Erstkontakt mit Antisemitismus fragt:
„Die nichtjüdischen Lehrer*innen beginnen ihre Interviewerzählungen zunächst überwiegend mit der Einschätzung, dass sie in ihrer Kindheit keine direkten Berührungspunkte mit Antisemitismus hatten. Dies führen sie auf den fehlenden Kontakt mit Jüdinnen und Juden und jüdischem Leben zurück. In dieser Verknüpfung drückt sich die Vorstellung aus, dass Antisemitismus unmittelbar mit jüdischer Präsenz zusammenhänge.“ (Chernivsky & Lorenz-Sinai, 2024, S. 20)
Diese Aussagen passen mit den Erkenntnissen zusammen, dass in deutschen Familien wenig über die eigene Vergangenheit in der NS-Zeit gesprochen wird.
Die Bundesländerstudienreihe zeigt weiter, dass sich institutioneller Antisemitismus in Schulen durch die Verharmlosung, Leugnung und das Ausblenden antisemitischer Strukturen, die unreflektierte Annahme jüdischer Abwesenheit, die Nichtbeachtung jüdischer kultureller und religiöser Praktiken sowie durch mangelnde Beschwerdewege bei entsprechenden Vorfällen zeigt. Jüdische Schüler:innen und Lehrkräfte können ihre religiöse und kulturelle Identität an deutschen Schulen kaum unbeschwert leben, da dies mit Diskriminierung und Sicherheitsbedenken verbunden ist. Das Bildungssystem ignoriert weitgehend jüdische Erfahrungen mit der Shoah und Antisemitismus, die Vielfalt jüdischen Lebens sowie praktische Bedürfnisse wie jüdische Feiertage oder koschere Verpflegung (Chernivsky & Lorenz-Sinai, 2024).
Mit Blick auf Antisemitismus an Schule ist es sinnvoll, ein erweitertes Verständnis heranzuziehen und einen Blick auf die Ausprägung von Antisemitismus in Institutionen zu werfen. Hierfür bietet sich der Terminus „institutioneller Antisemitismus“ an, da er weniger auf Verhalten und Einstellungen fokussiert, sondern darauf, wie soziale Ordnungen und Hierarchiegefälle, auch im Raum (Berufs-)Schule, hergestellt und immer wieder erneuert werden.
Institutioneller Antisemitismus
Beim institutionellen Antisemitismus wird Antisemitismus als gesellschaftliches Machtverhältnis verstanden, das sich in sozialen Praktiken und den Erfahrungen von Jüd:innen zeigt. Besonders in Institutionen wie Schulen, Hochschulen oder der Polizei manifestiert sich Antisemitismus, der in institutionellen Praktiken tradiert wird und die Gleichberechtigung, Teilhabe und Sicherheit jüdischer Communities betrifft (Chernivsky & Lorenz-Sinai, 2025). In der Geschichte führte die strukturelle Diskriminierung von Jüd:innen durch Verweigerung fundamentaler Menschenrechte immer wieder zu massiver Gewalt gegen jüdische Gemeinschaften und ermöglichte die Umsetzung der antisemitischen Vernichtungsabsicht. In der Nichtbeachtung der strukturellen Dimension sehen Chernivsky und Lorenz-Sinai (2025) einen Beweis der Normalisierung dieser Diskriminierung. Eine institutionenbezogene Antisemitismusforschung untersucht neben dem Auftreten antisemitischer Vorfälle implizites Wissen und Routinen im institutionellen Umgang mit Antisemitismus sowie die biografische Prägung von Fachkräften durch tradierte antisemitische Wissensbestände (Chernivsky & Lorenz-Sinai, 2024). Sie analysiert beispielsweise folgende Fragen:
Wurde und wird auch Antisemitismus in Form von Verfahrensweisen, Werten, Normen und Wissensbeständen in Institutionen und Organisationen institutionalisiert? Diskriminieren scheinbar neutrale Gesetze und Verfahrensweisen Juden:Jüdinnen? Und wenn ja, wo und wie geschieht dies genau? (Arnold & Karakayali, 2024)
Die Mehrheit der Jüd:innen in Deutschland hat eine Migrationsgeschichte. Antisemitismusforschung ist so zum Beispiel auch für das Verständnis antislawischen Rassismus wichtig, wobei nicht Gleichsetzungen, sondern die präzise Analyse von Unterschieden, Gemeinsamkeiten und möglichen Überschneidungen zwischen Antisemitismus und verschiedenen Rassismusformen im Fokus stehen sollte (vgl. ebd.). Diese Forschungsperspektive hat auch Auswirkungen darauf, wie Berufsschule als Institution in Bezug auf Diskriminierung analysiert wird und was es dort zu tun gibt.
Aufgrund der polarisierten gesellschaftlichen Diskurse sind die Diskussionen zu der Thematik auch in Klassenräumen oftmals stark emotionalisiert. Insbesondere antimuslimischer Rassismus und Antisemitismus werden zum Teil gegeneinander ausgespielt – nicht zuletzt im Kontext des schon seit Jahrzehnten andauernden Nahostkonfliktes. Lehrkräfte sollten hier eine ausgleichende und versachlichende Rolle einnehmen, die aber auch Platz für Emotionen lässt und vor diesen keine Angst hat. Nur so können die Verletzungen auf beiden Seiten ernst genommen und ein respektvolles Miteinander ermöglicht werden (Chernivsky & Lorenz-Sinai, 2024, S. 15–16).
Fußnote
[1] Das in Berlin ansässige Kompetenzzentrum für antisemitismuskritische Bildung und Forschung, ehemals „Kompetenzzentrum für Prävention und Empowerment“ (bis 2023), qualifiziert Fach- und Führungskräfte aus Bildung, Sozialer Arbeit und Verwaltung weiter und realisiert gemeinsam mit der Fachhochschule Potsdam Forschungsprojekte.
Es braucht an einer antisemitismuskritischen Schule mehr als die Vermittlung von Faktenwissen über Antisemitismus, Nationalsozialismus, Shoah und Nahostkonflikt [1], da Antisemitismus wesentlich auf der Konstruktion und Festigung nationaler Selbstbilder basiert. Diese müssen kritisch hinterfragt werden. Sprich, eine scheinbare Selbstverständlichkeit nationaler Identitätskonzepte zu problematisieren und die damit verbundenen Mechanismen zu analysieren: das Wechselspiel zwischen Selbst- und Fremdethnisierung, zwischen Ein- und Ausgrenzung sowie zwischen Aufwertung der eigenen und Abwertung anderer Gruppen (Haury, 2024, S. 32). Besonders deutlich wird dies in Debatten über Antisemitismus und den Nahostkonflikt, die stark von unterschiedlichen nationalen, religiösen und politischen Identitätsvorstellungen geprägt sind. Der Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 auf Israel führte zu einem starken Anstieg von Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus deutschland- und weltweit, wodurch ein deutlicher Handlungsbedarf entsteht (Fava, 2024, S. 119–120). Es braucht Räume, in denen der „Konflikt über den Konflikt“ thematisiert werden kann, um die eigenen Motivationen, Emotionen und Positionierungen zu reflektieren (Haury, 2024, S. 33).
Die von Rosa Fava formulierten Leitlinien können dabei helfen:
„Erstens: antisemitischen Deutungen des Nahostkonflikts und daraus resultierenden Handlungen entgegentreten – jüdische Jugendliche in den Blick nehmen. Zweitens: rassistischen Deutungen palästinensischer Proteste und damit verbundenen Konsequenzen entgegentreten – palästinensische Jugendliche ernst nehmen; antimuslimischem Rassismus entgegentreten.“ (Fava, 2024, S. 119)
Folgende zusammengefasste Erläuterungen zu den Leitlinien veranschaulichen, welche Beispiele in den Blick genommen werden müssen und ernst genommen werden sollten:
1. Verfälschende Narrative zum Hamas-Massaker
Nach dem Angriff der Hamas wurden die Gewaltakte in Teilen der palästinasolidarischen Szene als eine „legitime Form von Widerstand“ konstruiert und durch Verschwörungserzählungen relativiert. Diese Umdeutungen verharmlosen Terror und erschweren eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Geschehen.
2. Verdrängung jüdischen Lebens aus dem öffentlichen Raum
In der Folge des Massakers zogen sich viele jüdische Menschen zum Schutz vor gewaltsamen Übergriffen aus öffentlichen Räumen zurück. Auch jüdische Einrichtungen und Gedenkstätten wurden zunehmend Ziel von Angriffen, was (Re-)Traumatisierungen auslöste.
3. Israelbezogener Antisemitismus als Dauerproblem
Antisemitische Haltungen äußern sich häufig in Form überzogener oder einseitiger Israelkritik, in der beispielsweise das Existenzrecht Israels infrage gestellt oder das Agieren der israelischen Regierung mit dem Holocaust gleichgesetzt wird. Diese Erzählmuster sind weit verbreitet und prägen politische Diskurse sowie antisemitische Taten seit Langem.
4. Reaktivierung rassistischer Diskurse
Palästinasolidarische Proteste führten in der öffentlichen Debatte zu pauschalen Zuschreibungen von Antisemitismus an migrantische Gruppen. Alte rassistische Narrative über Integration und Zugehörigkeit wurden reaktiviert und instrumen- talisiert.
5. Repression palästinensischer Ausdrucksformen
Palästinensische Symbole und Äußerungen wurden vielfach vorschnell mit Terror gleichgesetzt und durch teils staatliche Repressionen unterdrückt. Dies führte zu Unsicherheiten im pädagogischen Alltag und verdrängte notwendige differenzierte Auseinandersetzung.
6. Marginalität palästinensischer Communities
Palästinensische Menschen in Deutschland erleben tiefgreifende soziale Ausgrenzung und politische Unsichtbarkeit. Ihre Perspektiven finden selten Gehör, was Frustrationen verstärkt (Fava, 2024, S. 121–124) und einen empathischen Dialog unter Menschen mit verschiedenen Betroffenheiten erschwert oder gar verhindert.
Der Blick „auf beide Seiten“ darf keine Verzerrung in Bezug auf die jeweilige gesellschaftliche und kollektive Situation beinhalten. Vielmehr müssen die unterschiedlichen Betroffenheiten möglichst genau und auch in ihrer Wechselwirkung betrachtet werden. Lernräume zu Diskriminierung, Hass und Gewalt sind von Traumata und Konflikten geprägt. Nach dem 7. Oktober 2023 gleichen sie laut Fava teils „Notaufnahmen“, da viele verletzt sind und Unterstützung brauchen. Zudem sind sie in gesellschaftliche Hierarchien eingebettet, die oft vereinfacht werden. Lehrkräfte müssen die Vielschichtigkeit erfassen. Für die Thematisierung des Nahostkonflikts ist eine differenzierte, antisemitismuskritische Bildungsarbeit essenziell, welche Formen des antimuslimischen Rassismus mitbearbeitet (Fava, 2024, S. 124).
Fußnote
[1] Mit Nahostkonflikt ist der Konflikt zwischen Israelis und Palästinenser:innen gemeint.
Antisemitismus zeigt sich in der Schule auch sprachlich – durch subtile, historisch geprägte Ausdrucksformen von Schüler:innen und Lehrkräften, die als sprachliche Gewalt wirken. In ihrer soziologisch-qualitativen Interviewstudie mit 251 jüdischen Schüler:innen, deren Eltern sowie jüdischen und nichtjüdischen Lehrkräften an 171 Schulen (2017–2019) zeigt Julia Bernstein (2020) auch, wie sich Antisemitismus im schulischen Alltag verbal äußert – etwa durch die Verwendung des Wortes „Jude“ als Schimpfwort auf deutschen Schulhöfen:
„Es ist einfach… normal, keiner denkt darüber nach. Ich könnte ja auch was Anderes sagen, ‚Arschlochʻ oder ‚Lauch‘, […] es hat keine Bedeutung, warum wir „Juden“ sagen. Es ist nichts Besonderes. Das sagt man halt einfach so.“ (Bernstein, 2020, S. 87).
Das Wort Jude wird dabei oft als Synonym für Geiz, Betrug, Gier, Opfer oder Schwäche genutzt (vgl. ebd.). In diesem Zusammenhang betont Bernstein Folgen für das Selbstbild jüdischer Schüler:innen. Neben dem, dass sich durch den Gebrauch des Wortes Jude antisemitische Stereotype und Differenzkonstruktionen wiederholen und gefestigt werden, werden jüdische Identitäten stigmatisiert, sodass die Aussage „ich bin Jüdin oder Jude“ oft mit schmerzhaften, negativen Gefühlen verbunden ist.
Antisemitische Sprache und Handlungen bleiben im Schulalltag häufig unbeachtet und wie eben beschrieben und als „normal“ bewertet – etwa Schmierereien, Drohungen oder eben Begriffe wie „Jude“ als Schimpfwort. Besonders wenn die Täter:innen anonym bleiben, reagieren Lehrkräfte oft nicht. Diese Passivität trägt zur Normalisierung antisemitischer Einstellungen bei. Auch Lehrkräfte selbst äußern Unsicherheiten im Umgang mit solchen Vorfällen (Chernivsky & Lorenz-Sinai, 2024, S. 43–44).
Jüdische Schüler:innen und Eltern fordern hingegen klare, ernst gemeinte Reaktionen: Beschwerden sollen ernst genommen, zeitnah bearbeitet und Betroffene einbezogen werden. In Bundesländern wie Berlin oder Baden-Württemberg gibt es bereits eine Meldepflicht für antisemitische Vorfälle. Dennoch bestehen häufig Unklarheiten über Kriterien, Zuständigkeiten und Verfahren, teilweise auch Widerstände aus Sorge um das Schulimage (vgl. ebd. S. 44–45).
Ein wirksamer Umgang mit antisemitischer Sprache erfordert daher klare Strukturen und pädagogisches Handeln zugleich: Lehrkräfte sollten antisemitische Äußerungen benennen, einordnen und dokumentieren. Transparente Meldewege, verbindliche Kriterien und kollegiale Unterstützung geben Sicherheit – und setzen ein klares Zeichen gegen Antisemitismus im Schulkontext.
Damit sind wir bei der Frage, wie Antisemitismus im Schulalltag wirkungsvoll begegnet werden kann. – Eine wirksame Prävention beginnt im Kollegium und setzt sich im Unterricht fort: Klare Beschwerdewege, ein sensibilisiertes Team und ein antisemitismuskritischer, fachübergreifender Unterricht können Ansatzpunkte sein. Berufsschulen haben dabei einen besonderen Vorteil: Ihr Praxisbezug eröffnet viele Möglichkeiten, antisemitische Denkmuster alltagsnah zu hinterfragen und Auszubildende für Vielfalt und respektvolles Miteinander in der Arbeitswelt zu stärken.
Angelehnt an Chernivsky und Lorenz-Sinai (2024, S. 51–54) können folgende Handlungsimpulse als Anregung für Veränderungsprozesse in der Institution Berufsschule genutzt werden. Diese finden in diesem Buch bereits an anderen Stellen zum Umgang mit Rassismus an Berufsschulen in ähnlicher Weise Erwähnung:
• Sensibilisierung von Lehrkräften für Antisemitismus
• Betrachtung antisemitischer Vorfälle als strukturelles Problem
• Ausbau von Schutz- und Beschwerdewegen
• Entwicklung fachübergreifender antisemitismuskritischer Unterrichtspraxis
• Vertiefte Auseinandersetzung mit Formen und Funktionen des Antisemitismus
• Befähigung von Lehrkräften, antisemitische Inhalte in Materialien zu erkennen
• Konsequenter Schutz betroffener Schüler:innen und Familien
• Strukturelle Schulentwicklungsmaßnahmen statt individueller Verantwortungszuweisung
• Klärung von Zuständigkeiten im Schulkollegium
• Unterstützung durch Schulleitung und -aufsicht
• Biografische Reflexionsangebote für Schüler:innen und Lehrkräfte
• Selbstreflexion von Fachkräften über eigene Haltungen und Deutungsmuster
• Kritische Betrachtung der Schulgeschichte in der postnationalsozialistischen Ge- sellschaft
Institutioneller Strukturscan: Entwickeln Sie ein visuelles Mapping-Tool (z. B. Freemind, recherchieren Sie sonst dazu passende Tools im Netz), mit dem Sie die strukturellen Dimensionen von Antisemitismus in Ihrer Berufsschule/ Universität/Praktikumsstelle erfassen können. Untersuchen Sie systematisch Bereiche wie Schulordnung, Festkalender, Raumgestaltung, Kantinenangebot und Unterrichtsmaterialien. Präsentieren Sie Ihre Ergebnisse in Form einer interaktiven Kurzpräsentation, die Handlungsbedarfe aufzeigt und strukturelle statt individueller Lösungsansätze vorschlägt.
Biografische Audio-Collage: Sammeln Sie kurze Audiobeiträge (1–2 Minuten) von Kommiliton:innen, Kollegium, Auszubildenden und/oder Familienmitgliedern zu persönlichen Berührungspunkten mit Antisemitismus oder familiären Geschichtsnarrativen. Komponieren Sie daraus eine anonymisierte Audio-Collage, die als Einstieg für eine kollegiale Reflexionsrunde zur eigenen biografischen Prägung dienen könnte.
Sie lesen lieber ein Buch?
Über die folgenden Schaltfläche kommen sie zu unserem OER-Buch: