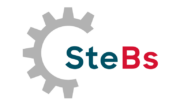Modul 4 |
Diskriminierungssensible Sprache
Diskriminierungssensible Sprache
Die Lerneinheit zur diskriminierungssensiblen Sprache startet mit einem kleinen Beispiel, das zu einem grundsätzlichen Nachdenken über Gender und Sprache einlädt. Es folgt eine Einordnung, wozu es notwendig ist, in der Berufsschule eine inklusive und diskriminierungssensible Sprache zu nutzen. Darauf folgt eine Auseinandersetzung über das generische Maskulinum. Abschließend werden praktische Umsetzungsanregungen gegeben, und es folgt eine Aufgabe, die zur Vertiefung des Themas dient.
- Einstieg
- Theorie
- Aufgaben & Reflexion
Ein kleines Beispiel zum Einstieg
Stellen Sie sich folgende Szene vor:
„In der Schule findet ein Elternabend statt. Die Klassenlehrerin hat sich vorgenommen, alle Eltern kennenzulernen. Nachdem sie die Namen fast aller Kinder bereits zugeordnet hat, fragt sie: „Wer gehört zu Max Schubert?“ Daraufhin hebt Dr. Schubert den Arm. Die Lehrerin lächelt. Dann bemerkt sie noch einen weiteren Arm: Von einem Mann, der etwas abseits in der Ecke sitzt.“ (Koordinierungsstelle Chancengleichheit Sachsen, 2021, S. 18).
Bevor Sie weiterlesen, überlegen Sie: Wer kann das sein? Zu wem gehört der weitere Arm?
Zu welchen Schlüssen sind Sie gekommen? Stand nach dem Lesen des Beispiels auch vor Ihrem inneren Auge zunächst eine „männliche“ Person, ein männlicher Dr. Schubert?
Die Nichtverwendung einer gendersensiblen Sprache kann zu Verwirrungen führen, und wichtige Informationen zum Verständnis des Kontexts können verloren gehen. Falls es sich hier nicht um den zweiten Vater im Kontext einer gleichgeschlechtlichen Beziehung oder einer familiären Variante von biologischem Vater/Stiefvater oder Ähnliches handelt, sondern um die Mutter des Kindes – wäre es wichtig, von Doktorin Schubert zu sprechen, der Mutter von Max. Eine ausschließliche Verwendung männlicher Formen führt zu einer kategorischen Unsichtbarmachung, Ausgrenzung und Diskriminierung von weiblichen und nicht-binären Personen, aber auch – wie in diesem Fall – zu Verständnisproblemen.
Für das Leben in einer immer weiter vernetzten und globalisierten Welt mit immer vielfältigeren Gesellschaften ist es angemessen und zeitgemäß, diskriminierungsbewusst zu sprechen. So wie Gesellschaft im Wandel ist, unterliegt auch Sprache dynamischen Veränderungen. Ziel von diskriminierungssensibler Sprache sollte demnach nicht sein, universal gültige Normen zu erstellen. Ein Punkt, an dem die Offenheit für neue Impulse aus gesellschaftlichen Diskursen sichtbar wird, ist die Diskussion rund um das generische Maskulinum [1]. Dieses gilt aus einer diskriminierungskritischen, menschenrechtsorientierten Perspektive als überholt.
Überlegen Sie:
Was für ein Bild erscheint beispielsweise in Ihren Köpfen, wenn wir von stark, tapfer, heldenhaft sprechen und was für eines, wenn wir von weich, liebevoll, sorgend sprechen?
Ähnliches passiert, wenn das generische Maskulinum genutzt wird, also „der Lehrer“ oder „der Arzt“ als Sammelbezeichnung genutzt werden. In den meisten Fällen erscheinen männliche Personen vor unserem inneren Auge. Dies hat auch mit der Geschichte der männlichen Dominanz in bestimmten Berufen zu tun und ist in historische und gesellschaftliche (Selbst-)Verständnisse eingebunden. Diese verinnerlichten Bilder sind jedoch problematisch. Denn ein Großteil der Lehrpersonen und Ärzt:innen wird ausgeklammert und sprachlich nicht mitgedacht. Dies war in Zeiten, in denen Berufsbilder klarer in männliche und weibliche Tätigkeitsfelder unterteilt waren, vielleicht unproblematisch. Um gegenwärtige Verhältnisse gut abbilden zu können, braucht es jedoch eine Anpassung der Sprache. Denn im deutschen Wortschatz sind Wörter durch die Artikel dichotom männlich – weiblich besetzt: „der Mann – die Frau“; „die Nonne – der Mönch“; „der Vater – die Mutter“; „die Lehrerin – der Lehrer“ etc. Dieser Zusammenhang ist in der deutschen Sprache so allgegenwärtig, dass es – ähnlich wie im Englischen „the“ (the teacher, the professor etc.) – zuerst einer Auflösung der Artikel „der“ und „die“ bedürfte, bevor das generische Maskulinum wirklich als neutral genutzt werden könnte.
Ziel von diskriminierungssensibler Sprache im Berufsschulkontext ist es, für Diskriminierung auf sprachlicher und schriftlicher Ebene ein Gehör zu entwickeln.
„Sprache, das ist eine simple Weisheit, ist nicht neutral und nie harmlos. Sprache ist ein ernstzunehmendes Machtinstrument, welches Diskriminierungspraxen […] normali- siert.“ (Castro Varela, 2019, S. 4).
Doch Sprache kann nicht nur ausschließen, verletzen und diskriminieren. Sprache ist ebenso ein wichtiges Werkzeug zur Bekämpfung ebendieser Phänomene. Ziel diskriminierungssensibler Sprache ist es, Aufklärungs- und Präventionsarbeit zu leisten, um Diskriminierung und Ungleichwertigkeitsvorstellungen, die sich nicht zuletzt auch auf einer sprachlichen Ebene transportieren, zu reduzieren (vgl. Meier-Vieracker, 2019, S. 3). Dafür ist es nicht nur wichtig, den eigenen Sprachgebrauch als Berufsschullehrende:r zu reflektieren, sondern auch verinnerlichte Normen, Einstellungen und Haltungen gegenüber marginalisierten Personen oder Gruppen kritisch anzusehen, bewusstzumachen und diese umzulernen. Diskriminierungssensible Sprache ruht sich demnach nicht darauf aus, Minderheiten „mitzumeinen“, sondern sorgt für eine respektvolle und gleichberechtigungsorientierte Sichtbarkeit (vgl. ebd.). Dieses Umlernen eigener Sprechweisen und dahinterliegender Vorstellungen ist ein Prozess, der Berufsschullehrkräfte, wie alle Pädagog:innen, die für Lernende verantwortlich sind, permanent begleiten sollte. Hierbei sollten wir uns im Klaren sein, dass Umlernen auch immer mit Fehlermachen verbunden ist und wir eine fehlerfreundliche Haltung uns selbst und anderen gegenüber brauchen, um den langwierigen Prozess nicht frustriert abzubrechen.
Fehlerfreundlichkeit
Das Umlernen eigener Vorstellungen von Welt und der damit einhergehenden Reflexion des eigenen Sprachgebrauchs ist ein lebenslang andauernder Prozess. Wie in allen Lernsituationen kommt es auch hier zu Fehlern, das gehört dazu. Davon sollte sich niemand entmutigen lassen – vor allem nicht Lehrer:innen, die nicht nur Sprachvorbilder für ihre Schüler:innen sind, sondern auch in Bezug auf den Umgang mit Fehlern ermutigende und konstruktive Wege aufzeigen können.
Fußnote
[1] Das generische Maskulinum meint das ausschließliche Nutzen der grammatikalisch männlichen Form von Wörtern. Es behauptet, weibliche, trans oder nicht-binäre Menschen mit einzuschließen. Diese grammatikalische Form ist nicht nur ungenau, sondern diskriminierend, weil sie eine Unsichtbarmachung vieler Menschen zur Folge hat.
Nachdem es lange Zeit vor allem um die Berücksichtigung aller Geschlechter in der Sprache und eine nicht-sexistische Sprache ging, sind inzwischen auch vermehrt Stimmen hörbar, die sich dafür einsetzen, dass auch rassistische, ableistische, klassistische Elemente der deutschen Sprache verändert werden. Dabei geht es darum, historisch rassistisch aufgeladene Wörter wie das N-Wort, beleidigend gemeinte Sprüche wie:
„Bist du behindert/schwul/Jude etc.?“ oder auch die Abwertung entlang von sozioökonomischem Status als beispielsweise „asozial“ o. Ä. zu vermeiden. Dazu ist es für (angehende) Berufsschullehrende zunächst notwendig, sich mit Differenzordnungen und verschiedenen Facetten der Diskriminierung auseinanderzusetzen, um dadurch erkennen zu können, welche Art der Sprache zu sprachlicher Abwertung beiträgt beziehungsweise welche Art der Sprache eine solche Abwertung und Ausgrenzung vermeidet.
Im Folgenden werden Umsetzungsmöglichkeiten am Beispiel der geschlechterinklusiven Sprache ausgeführt. Im Rahmen der Aufgabenstellung am Ende dieser Einheit setzen Sie sich dann in Eigenarbeit mit Reflexions- und Umsetzungsmöglichkeiten für rassismus-/ ableismus-/ und klassismuskritische Sprache auseinander.
Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Substantivierungen wie „Studierende“. In den letzten Jahren sind auch nicht-binäre Schreibweisen wie das Gender-Sternchen oder Asterisk (Student*innen), der Gender-Gap beziehungsweise Unterstrich (Stu- dent_innen) und der Gender-Doppelpunkt (Student:innen) entstanden. Das Wort
„gender“ kommt aus dem Englischen und bedeutet Geschlecht. Mit gender ist nicht das biologische Geschlecht (im Englischen „sex“) gemeint, sondern das soziale, gelebte, gefühlte Geschlecht und die Geschlechtsidentität [1] (vgl. die sehr interessante und weiterführende Website Genderdings, 2024). Wenn also vom „Gendern“ die Rede ist, geht es primär um geschlechterinklusive Sprache, mit der sich nicht nur „Männer“ oder „Frauen“, sondern alle weiteren Geschlechtsidentitäten mitgedacht und angesprochen fühlen können. Das können beispielsweise intersexuelle oder auch nicht-binäre Menschen sein.
Es gibt keine einheitliche Regelung oder Norm für gendergerechte Sprache, folglich kann es auch kein eindeutiges „richtig“ oder „falsch“ in der Art des Genderns geben. Was in diesem Text allerdings gezeigt wurde, ist, dass das generische Maskulinum keine Form für diskriminierungsbewusste, gendersensible und inklusive Sprachhandlungen darstellen kann. Als Berufsschullehrende:r ist es daher notwendig, sich mit Formen des Genderns selbst auseinanderzusetzen und im Unterrichtsgeschehen sensibel zu sprechhandeln. Dazu sollten folgende Grundsätze beachtet werden:
• Anwendung geschlechterinklusiver Begriffe: Zum Beispiel: Lehrkräfte/Lehrpersonen/Lehrende/Lehrer:innen statt Lehrer
• Persönliche Ansprache im Klassenraum (Herr:Frau, sie:er etc.): Namen und das äußere Erscheinungsbild allein lassen keine Rückschlüsse auf die Genderidentität zu. Es ist daher hilfreich, darauf zu achten, ob einzelne Schüler:innen in der Klasse eventuell eine andere Anrede/ein anderes Pronomen nutzen, als Sie es vom äußeren Erscheinungsbild erwartet hätten – oder vielleicht auch keine/s nutzen. Wenn Sie Anrede und Pronomen erfragen, sollten Sie darauf achten, dass es nicht zu einem „Zwangsouting“ kommt und diese Abfrage eventuell vor Kursbeginn per Mail durchführen.
• Diskriminierende Sprache sanktionieren: Wenn es zu diskriminierenden Sprachhandlungen kommt, ist es wichtig, darauf zu reagieren und aufzuzeigen, dass diese einer respektvollen, menschenrechtsorientierten und demokratischen Schulkultur widersprechen. Auch zum Schutz von potenziellen Betroffenen ist direktes Reagieren notwendig. Manchmal fällt es Ihnen vielleicht schwer, direkt in der Situation zu erkennen, welche Reaktion die passende ist. Greifen Sie den Vorfall dann mit Abstand noch einmal in Ruhe in der nächsten Stunde mit der Klasse auf. Gerade über Verletzungen lässt sich oft besser mit etwas Abstand sprechen. Wichtig ist nur, dass es nicht dauerhaft unbesprochen bleibt.
Fußnote
[1] Mit Geschlechtsidentität ist das innere Wissen gemeint, das Menschen darüber haben, wie sie sich selbst im Geschlechterspektrum verorten. Die Geschlechtsidentität ist von äußeren Faktoren beeinflusst und kann sich im Laufe des Lebens wandeln (vgl. genderdings online).
Hören Sie sich die Folge „Was Sprache macht – mit Alice Hasters und Maxi- miliane Haecke“ vom BBQ Podcast an. Hier sprechen zwei Personen noch einmal von ihren eigenen Lernerfahrungen im Kontext der diskriminierungssensiblen Sprache. Welche zusätzlichen Impulse für die Entwicklung Ihrer eigenen pädagogischen Professionalität in Bezug auf Sprache konnten Sie gewinnen? Bitte formulieren Sie diese mit einem konkreten Rückbezug auf die Inhalte des Podcasts. Sie finden ihn frei zugänglich unter diesem Link: https://www1.wdr.de/mediathek/audio/cosmo/bbq-der-black-brown-queere- podcast/audio–was-sprache-macht-100.html.
Im Text lag der Fokus stark auf einer Sensibilität für eine geschlechtergerechte Sprache. Recherchieren Sie selbst nach den Stichworten: Rassismuskritische und Ableismuskritische Sprache und stellen Sie jeweils drei Beispiele für sensible Sprechweisen aus diesen Bereichen vor, die Ihnen bisher unbekannt waren. Bitte geben Sie dabei die Quellen Ihrer Recherche an.
Anregungen für die Recherche
Titel | Inhalt | Link |
Amnesty International | Leitfaden inklusive Sprache | https://www.amnesty.ch/de/ueber-amnesty/inklusive-sprache/inklusive-sprache-uebersicht/leitfaden-inklusive-sprache-de.pdf |
Ausgesprochen Vielfältig | Diversitätssensible Kommunikation in Bild und Sprache | https://www.kc-sachsen.de/fileadmin/user_upload/Veroeffentlichungen/Publikationen/2104_Koordinierungsstelle_Ausgesprochen_vielfaeltig_PDF.pdf |
FUMA | Geschlechtergerechte Sprache | https://www.gender-nrw.de/geschlechtergerechte-sprache/ |
Der Herkunftsdialog – diskriminierungssensible Sprache | Das kurze Video zeigt, wie Sprache Ausgrenzung schafft und diskriminiert | https://www.youtube.com/watch?v=nURgTeFDGU0 |
Hörbeispiel | So klingt gendergerechte Sprache für Blinde mit einem Screenreader | https://www.youtube.com/watch?v=b_LcUtmCTEo |
Sie lesen lieber ein Buch?
Über die folgenden Schaltfläche kommen sie zu unserem OER-Buch: